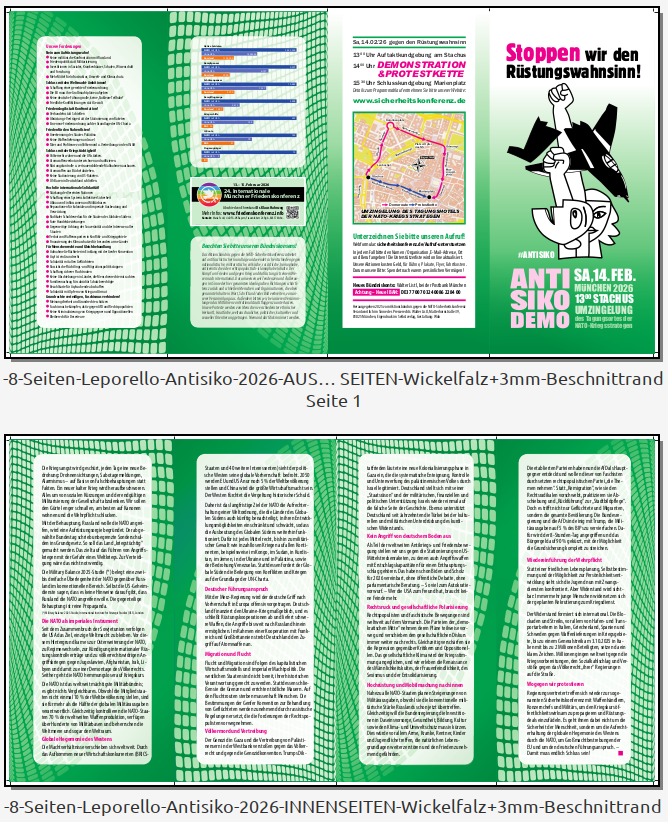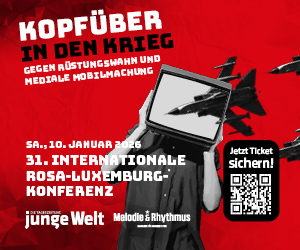Meldungen
Eine wichtige Mitteilung an unsere Mitglieder und Spender*innen
Konjunktur 2025. Deutschlands Wirtschaftswachstum um den Nullpunkt
Die deutsche Konjunktur 2025 ist geprägt durch Stagnation mit einem zeitlich begrenzten minimalen Wachstum, schwacher Produktivität und zunehmendem industriellen Stellenabbau.
Nach der vorausgegangenen Rezession, einem über zwei Quartale hinausreichenden Wachstumsrückgang, kam die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts im Verlauf des Jahres 2025 nahezu zu einem Stillstand. Für das Gesamtjahr wird ein offizielles Wachstumsergebnis von 0,2 % angegeben.
Nach den Quartalsergebnissen ist für das Gesamtjahr 2025 als eine schwache konjunkturelle Bewegung um die Null-Linie zu bezeichnen.
Unter Verteilungs‑, Klassen‑ und Strukturgesichtspunkten verschärft ein solches „Mini‑Wachstum“ bestehende Ungleichheiten, die sich mit Blick auf die aktuelle Regierungspolitik im weiteren Verlauf der Legislatur-Periode eher verschärfen statt abgebaut zu werden. Das BIP‑Wachstum von 0,2 % sagt kaum etwas über Lebensqualität, öffentliche Daseinsvorsorge, ökologische Nachhaltigkeit oder Verteilung aus; soziale Kosten werden im BIP sogar als „Wertschöpfung“ verbucht.
Ein Blick auf die Entwicklung des BIP im Zeitraum der vergangenen 10 Jahre zeigt, dass sich seit r 2021 ein kontinuierlich rückläufiges Wachstum abzeichnete, was die Rezession trotz des minimalen Wachstumsanstiegs in 2025 belegt.
Für die Beschreibung der wirtschaftlichen Entwicklung werden generell drei Indikatoren angewandt:
1. Konjunktur beschreibt den zyklischen Wechsel zwischen wirtschaftlich starken und schwachen Perioden der Wirtschaftsentwicklung. Auf Basis einer Vielzahl von zumeist quartalsmäßig erhobenen Konjunkturindikatoren läßt sich die Konjunkturentwicklung angeben und abbilden.
2.Bruttoinlandsprodukt (BIP) gilt als der zentrale Gradmesser für die Bestimmung von Wirtschaftsleistung und Wirtschaftswachstum. Das BIP misst den in Geld ausgedrückten Wert aller in einem Jahr produzierten Waren und Dienstleistungen innerhalb der Landesgrenzen. Es ist die Einkommensgröße (Summe von Löhnen, Profiten, Zinsen, Mieten, indirekten Steuern minus Subventionen), soweit diese Einkommen in der offiziellen Geldwirtschaft erfasst werden. Ein großer Teil des gesellschaftlichen Reichtums erscheint gar nicht im BIP: Hausarbeit, Selbstversorgende Produktion, Naturleistungen sowie der bereits vorhandene Kapitalstock, auf dem die jährliche Produktion beruht. Entscheidend dabei ist, dass der in der Produktion geschaffene Wert sich aufspaltet in konstantes Kapital (v, Produktionsmittel), variables Kapital (Lohnsumme) und Mehrwert (Profit, Zins, Grundrente, u. a.).
3. Bruttosozialprodukt (BSP) misst die Wertschöpfung oder das Einkommen aller Inländer, unabhängig davon, ob diese im Inland oder Ausland entsteht. Der Begriff ist jedoch veraltet und wird heute meist als Bruttonationaleinkommen (BNE) bezeichnet.
Zur Verteilung des „Kuchens“
Die gängige Frage nach der Aufteilung des zu verteilenden Kuchens der gesamten Wirtschaftsleistung suggeriert, das BIP sei ein gesamter Kuchen, eine neutral erzeugte Gesamtmasse, die politisch „gerecht“ zwischen Gruppen verteilt werden könne.
Nach marxistischer Auffassung ist der gesellschaftliche „Kuchen“ selbst bereits das Ergebnis kapitalistischer Produktionsverhältnisse – also eines Systems, das auf Privateigentum an Produktionsmitteln und der Trennung von Kapital und Arbeit beruht. Die entscheidende Verteilungsfrage lautet daher nicht, wie das Bruttoinlandsprodukt zwischen Kapital, Arbeit und Staat aufgeteilt wird, sondern wie groß der Anteil des von den Beschäftigten geschaffenen Wertes ist, der als Mehrwert angeeignet wird und sich einer gerechten Verteilung entzieht.
Der Staat tritt in dieser Perspektive nicht als eigenständige „Einkommensklasse“ neben Kapital und Arbeit auf, sondern als Instanz, die über Steuern und Ausgaben durch die gegenwärtige Regierungskoalition aufrüstungsorientiert systemstabilisierend umverteilt.
Zur Globalen BIP-Entwicklung
Das globale reale BIP-Wachstum zu Marktwechselkursen belief sich 2025 auf etwa 2,6%.
Dies stellt einen leichten Rückgang gegenüber den 2,8 % im Vorjahr 2024 dar. Der Trend der Verlangsamung resultiert primär aus geopolitischen Krisensituationen, unterschiedlichen Inflations-Dynamiken und regionalen Wachstumspfaden, wobei die USA durch eine expansive Fiskalpolitik und technologiegetriebene Investitionen eine wirtschaftliche Expansion aufwiesen. Für Deutschland zeigt sich demgegenüber eine unverändert wirkende Strukturkrise in bedeutenden industriellen Sektoren, der mit einer koordinierten Strukturpolitik zu begegnen wäre.
Schwache Produktivität und strukturelle Schwäche
Die Produktivitätsentwicklung Deutschland, Frankreich, USA und China, gemessen als preisbereinigtes BIP je Erwerbstätigenstunde weist über die letzten 10 Jahre, 2015–2024, eine Stagnation oder Verlangsamung in den westlichen Ländern aus.
Schon seit 2010 ergibt sich für Deutschland eine Verlangsamung der Produktivitätsentwicklung, zurückzuführen hauptsächlich auf eine Stagnation im Verarbeitenden Gewerbe.
Die gesamtwirtschaftliche Arbeitsproduktivität geht in 2025 im Vergleich zu 2024 um 0,5– 0,8% weiter zurück. Damit vergrößert sich der Abstand zu den internationalen Spitzenreitern, USA und China. Für Frankreich ergibt sich in der Zeitreihe ein ebenfalls niedriges Wachstum, rutscht in 2023 gar in den negativen Bereich. Die US-amerikanische Wirtschaft erscheint stabiler als in Europa. Das Wirtschaftswachstum in China pendelt im Vergleichszeitraum zwischen 6,9 % und 4,8%, mit Ausnahme des weltweit zu verzeichnenden Corona-Einbruchs in 2020. Das entspricht einer durchschnittlichen Rate von 5,0 %.
Produktivitätsentwicklung ausgewählter Länder von 2015 - 2024
Bruttoinlandsprodukt der G7 und China im Jahr 2025
Für das Jahr 2025 ergibt ein Ländervergleich der G7 und China für das Wachstum ein aufschlussreiches Bild: Die G7-Volkswirtschaften (mit Ausnahme der US-Wirtschaft) hatten Mühe, in 2025 um mehr als 1 % zu wachsen; die US-Wirtschaft, die im Jahr 2024 um 2,8% wuchs, erreicht in 2025 ca. 2,0 %. Demgegenüber wuchs die chinesische Wirtschaft in 2024 um 5,0% und erreicht in 2025 wiederum 5,0%, immer noch mehr als doppelt so viel wie die USA.
In einem Langzeitvergleich zwischen 2015 und 2024 lag das reale BIP‑Wachstum der G7 insgesamt im Mittel bei rund 1,2–1,5 Prozent pro Jahr, wobei sich deutlich unterschiedliche nationale Dynamiken herausbildeten. Die USA erzielten über weite Strecken Wachstumsraten von teils deutlich über 2 Prozent, während Deutschland, Frankreich und Italien immer häufiger nur um 1 Prozent oder darunter wuchsen, Japan häufig noch schwächer blieb und damit die Divergenz innerhalb der G7 sichtbar zunahm.
Inflation
Die Inflation lag in Deutschland in 2025 im Jahresdurchschnitt bei 2,2 %, wobei die
Kerninflation, d.h. Jahresteuerungsrate ohne Berücksichtigung von Energie und Nahrungsmitteln, bei +2,8 %, nach +3,0 % im Jahr 2024 und +5,1 % im Jahr 2023 lag. Die einschränkende Auswirkung auf die Kaufkraft vieler Menschen blieb somit bestehen. Besonders Ärmere litten stärker, da Lebensmittel und Mieten teurer wurden und das Bürgergeld (ehemals Hartz IV) bei einem Regelsatz von 563 Euro für Alleinstehende unverändert blieb. Die nominale Lohnentwicklung zeigte mit 3,7% zwar tendenziell nach oben, erbrachte allerdings nach Abzug der Inflation nur einen realen Zuwachs von 1,5 %. Somit wurden die Preiserhöhungen keinesfalls ausgeglichen. Die anhaltende Teuerung bei den Energiepreisen und die preislichen Auswirkungen der Lieferengpässe für Verbraucher werden vermutlich eine bedeutende Rolle spielen in den 2026 anstehenden Tarifverhandlungen,
Stellenabbau in Deutschland
Insgesamt hat die Industrie in Deutschland im Jahresvergleich bis Mitte/Ende 2025 über 100.000 Stellen abgebaut; seit 2019 gingen rund 250.000 Industriearbeitsplätze verloren. Die Automobil-Industrie steht vor einer tiefgreifenden Krise, die Rüstungsindustrie profitiert von außen-politischen Konflikten und der rechtskonservativen Wirtschaftspolitik, während die Energie-Industrie mit der dringenden Transformation hin zu erneuerbaren Energien konfrontiert ist. In allen drei Bereichen erhärten sich die strukturellen Herausforderungen für die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Beschäftigung.
Die Automobilindustrie hat im Jahr 2025 rund 48.800 Stellen abgebaut, was einem Rückgang von etwa 6,3% entspricht – der stärkste Stellenabbau aller großen Industriebranchen. Die Profitabilität ist massiv gesunken: Die Gewinne der großen deutschen Autokonzerne brachen im ersten Halbjahr 2025 um 38% ein, bei einigen internationalen Konkurrenten sogar noch stärker.
Große Hersteller wie VW, Bosch und der Zulieferer Mahle haben weitere massive Stellenabbau-Programme bis 2030 angekündigt. Deutliche Rückgänge gibt es auch in Metallerzeugung und ‑Bearbeitung (rund −5,4%), Kunststoffindustrie (rund −2,6%) sowie Metallerzeugnisse (rund −2,5%).
Die Chemie-Industrie steht ebenfalls unter Druck. Die heimischen Betriebe haben seit 2021 mehr als 20 Prozent des Produktionsvolumens reduziert, und die Auslastung der heimischen Anlagen ist so niedrig wie seit 30 Jahren nicht mehr. Der Druck zur Restrukturierung in den Unternehmen nimmt deutlich zu. Bedrohlich ist die strukturelle Krise vor allem für mittelständische Betriebe, nachdem diese über vergleichbar wenig Mittel verfügen, um einer Expansion in Wachstumsregionen wie Asien zu folgen. Dennoch sind sie sehr bemüht, zunächst ihre qualifizierten Fachkräfte als Standort-Trumpf beizubehalten.
Die Auflistung der wichtigsten Industriezweige in Deutschland 2025 zeigt ein klares Bild des Stellenabbaus:
Stellenabbau in zentralen Industriebranchen
Interne Einfluss-Faktoren der deutschen Konjunkturkrise 2025 - Bedarf an modernen Strukturen
Zu den internen Faktoren der anhaltenden Wachstumsstagnation gehören zuvorderst die strukturellen Schwächen des in Deutschland kapitalistischen Wirtschaftssystems. Diese reichen über die systemimmanenten zyklischen Effekte einer kapitalistischen Marktwirtschaft hinaus: Unternehmen halten Investitionen massiv zurück. Die Konjunktur-Stagnation und der schleppende Strukturwandel führen zum Aufschub von Projekten in IT, Investitionen in Forschung und Zukunftsentwicklung. Dabei sind vor allem die schleppende Digitalisierung und Innovationsdefizite anzugeben. Deutschland hinkt in der digitalen Infrastruktur, der Technologienutzung und den fachlichen Kompetenzen deutlich hinter internationalen Konkurrenten wie den USA, Skandinavien, China und Südkorea hinterher. Beispielsweise erreicht der Breitbandausbau (Glasfaser) lediglich 40% der Haushalte, während der Durchschnitt der OECD-Länder bei über 70% liegt; ländliche Regionen und Mittelstand sind hierbei besonders benachteiligt.
Im Hinblick auf die derzeit propagierte Investition in Industrie 4.0 als technologischer Paradigmenwechsel, das für moderne Unternehmen propagierte Cloud-Computing und die Investition in KI als derzeitige Wunderwaffe für mehr Wachstum bleibt allerdings kritisch anzumerken: Industrie 4.0 aus sozialkritischer Perspektive erhebliche strukturelle Risiken, insbesondere hinsichtlich sozialer Verteilung, Qualifikationslücken und Abhängigkeiten. Kritisch zu bewerten sind vor allem die drohende Prekarisierung durch Automatisierung, unverhältnismäßige Investitionsbarrieren für Kleine und Mittlere Unternehmen sowie ungelöste Datenschutz- und Cybersicherheitskonflikte, die die Abhängigkeit von globalen Tech-Konzernen (USA) verstärken. Zudem bleibt festzuhalten, daß unter kapitalistischen Produktionsbedingungen Investitionen in vernetzte Produktion, Plattformen und KI primär keiner allgemeinen gesellschaftlichen Wohlstandslogik wie Dekarbonisierung, Pflege oder Bildung erfolgen, sondern auf Rationalisierung, Senkung der Lohnkosten und Erschließung neuer Profitquellen mit hoher Renditeerwartung erfolgen. Einen generell belegbaren Nachweis einer Produktivitätssteigerung durch KI gibt es derzeit ohnehin nicht. Es gibt aber deutliche Hinweise auf eine potenzielle Blase bei KI-Investitionen, da die massiven Kapitalzuflüsse die tatsächlichen Erträge bei Weitem übersteigen und Bewertungen spekulative Höhen erreichen.
Die Technologienutzung bleibt in Deutschland trotz allem generell rückständig. Digitalisierungsraten in Verwaltung und Produktion stagnieren seit Jahren auf niedrigem Niveau, zumal die Beschäftigten mangels betrieblicher Weiterbildung nicht ausreichend über digitale Basiskenntnisse verfügen.
Mängel im Verkehrs- und Energiesektor hemmen das Wirtschaftswachstum nachhaltig und verschärfen die Konjunkturschwäche. Der Straßen- und Schienenverkehr litt auch in 2025 weiterhin unter maroden Zuständen: Rund 15% der Bundesstraßen sind defekt, Brücken und Schienennetze veralten, was zu Staus, Lieferverzögern und höheren Logistikkosten führt – die Deutsche Bahn meldet 2025 weiterhin massive Verspätungen und Kapazitätsengpässe. Im Energiesektor fehlen Investitionen in Netzausbau: Der Übergang zu Erneuerbaren Energien stößt auf Engpässe durch unzureichende Übertragungsnetze (Netzstabilität nur bei 85% Lastdeckung), was Industrieausfälle in energieintensiven Branchen wie Chemie und Stahl verursachte und die Wettbewerbsfähigkeit mindert. Diese Defizite belasten wie oben ausgeführt zusätzlich die stagnierende Produktivität. Öffentliche Investitionen sind dringend erforderlich.
Die ökologische digitale Transformation impliziert strukturell die Mobilisierung erheblicher Investitionsvolumina in nachhaltige Infrastrukturen und technologische, an den gesellschaftlichen Bedürfnissen orientierte Innovationen. Sie bleibt aber aufgrund der Profitlogik und mangelnder gesellschaftlich orientierter Steuerungsimpulse aus.
Mangel an ausgebildeten Fachkräften. Trotz der Konjunkturstagnation meldet jedes dritte Unternehmen (28,3%) Engpässe bei qualifizierten Kräften. Im März 2025 übertraf erstmals seit Corona die Zahl qualifizierter Arbeitslose von 1,24 Mio. die Zahl an offenen Stellen von 1,15 Mio. Besonderen Mangel an offenen Stellen gibt es bei Bauberufen, Sanitärtechnik und MINT-Bereichen; dies sind Berufe und Ausbildungen, die technisches, mathematisches und naturwissenschaftliches Wissen erfordern. Sie bilden den Kern des Innovationssektors und sind im Kontext des Fachkräftemangels besonders relevant.
Demografischer Wandel. Aus sozialwissenschaftlicher Sicht beschreibt der demographische Wandel eine schrumpfende Erwerbsbevölkerung: Bis 2035 gehen durch den Renteneintritt der Babyboomer rund 4,2 Millionen Erwerbstätige (15–64 Jahre) verloren, während die Geburtenraten niedrig bleiben und die Bevölkerung altert. Parallel bremsen massive Bildungsdefizite den Nachwuchs: Etwa 3 Millionen Jugendliche unter 25 Jahren verfügen über keinen Schul- oder Berufsabschluss, was zu einem chronischen Mangel an qualifizierten Einstiegsfachkräften führt – insbesondere in MINT-Berufen und Handwerk. Dieses Doppeldefizit verschärft den Fachkräftemangel gerade in der Konjunkturkrise, da überarbeitungsbedürftige Qualifikationen und nahezu ausbleibende Weiterbildungen die Industrieproduktion und Investitionen zusätzlich behindern.
Externe Faktoren der Konjunkturkrise
Externe Faktoren verschärfen zudem die deutsche Konjunkturkrise 2025 und treffen die exportabhängige deutsche Wirtschaft besonders hart. Ein globales Wachstum von 2,6 %, kombiniert mit den bekannten geopolitischen Konflikten Ukraine-Krieg, Nahost-Eskalation und Handelskonflikten führen zu einer Umorganisation globaler Wertschöpfungsketten: Der USA/China-Konflikt und US-Strategien wie „Inflation Reduction Act“ und „Chips Act“ ziehen Investitionen und Produktion weg von Europa, wodurch deutsche Exporte für den Automobil-Sektor und Maschinenbau nachweislich um 5–7% einbrechen.
Das anhaltend hohe Energiepreisniveau (Gaspreise 2025: 40–50 €/MWh, Strom industriell von 15–20 ct/kWh) und eine unsichere Energiepolitik verschlechtern die Kostenposition energieintensiver Branchen wie Chemie, Stahl und Glas. Zurückzuführen ist dies primär auf den aggressiven Fracking-Gas- Verkaufsdruck der USA , aber auch anderen Regionen wie dem Mittleren Osten. Die Deutsche Industrie zahlt 2–3 mal höhere Energiepreise, was die Profitabilität der Unternehmen signifikant drückt, die Investitionszurückhaltung bestimmt und stattdessen Produktions-Verlagerungen z. B. in das osteuropäische und asiatische Ausland befördert.
Aufrüstung und Kriegspolitik in Europa, allen voran Deutschland mit 2,5% des BIP für Verteidigung in 2025 lenken Milliarden in militärische Ausgaben z. B .für Rheinmetall und Hensoldt, statt in sozial-ökologische Modernisierung des Energieausbaus und der rückständigen Digitalisierung. Die Beschäftigung in der Rüstungsindustrie ist im Vergleich zur Automobilindustrie steigend. Die Profitabilität bleibt hoch, da sich Aufrüstung über den Jahreswechsel hinaus durch die internationale Nachfrage und die Auftragslage durch die schuldenfinanzierten staatlichen Großaufträge manifestiert; siehe weiter unten, Stichwort militärischer Keynesianismus.
Dies schafft kein tragfähiges ziviles Wirtschaftswachstum und fördert nicht die Binnennachfrage, sondern vertieft Abhängigkeiten von US-Technologie und Rohstoffen, während gleichzeitig zivile Investitionen stagnieren.
Ausblick 2026: Stagnation und Risiken
Für die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland ergibt sich für2026, nach drei Jahren Stagnation/Rezession, ein eher unverändertes Bild der wirtschaftlichen Stagnation mit einem geringen Wachstum.
Die anhaltende Schwäche im Privatkonsum sowie die weitere Zurückhaltung bei Investitionen prägen den Wirtschaftsverlauf, während Unternehmens-Insolvenzen und Stellenabbau voraussichtlich höchste Stände im Zehnjahresverlauf verzeichnen werden. Die Arbeitslosenquote dürfte sich um die 6 % über das Jahr erstrecken. Insofern ist nicht von einer Überwindung der strukturellen Krise auszugehen, sondern allenfalls ergibt sich eine bloße Stabilisierung innerhalb des kapitalistischen Akkumulationszyklus: Überakkumulation in den traditionellen Branchen Automobil- und Zulieferung sowie Chemie. Die Kapital-Akkumulation setzt sich in übermäßigem Umfang fort. Doch seine profitable Verwertung stößt an Grenzen, da die deutschen Exporte zurückgehen, die ungenutzten Kapazitäten von Industrieanlagen von derzeit 25 % verharren, die sinkenden Profitraten werden zu weiteren Einschränkungen bei den Lohnbeschäftigten und zu weiterem Abbau von Arbeitsplätzen führen. 2026 soll eine eine große Tarifrunde für rund 10 Millionen Beschäftigte erfolgen, hauptsächlich in DGB-Gewerkschaften wie Öffentlicher Dienst, Chemie, Einzelhandel, Metall- und Elektroindustrie. Wirtschaftspolitische Forderungen aus Sicht der Lohnbeschäftigten lassen sich in diesen anstehenden Auseinandersetzungen gut platzieren.
Die Konjunktur-Krise ist Ausdruck einer Überakkumulationskrise der deutschen Wirtschaft. Selbst optimistische Szenarien der etablierten Wirtschaftsforschungs-Einrichtungen basieren auf fragilen Annahmen einer Senkung der Inflation auf 2%, bei einem Wachstum von ca. 1%. Realistisch droht eher eine anhaltende Stagnation, (Bundesbank-Prognose: 0,6%), da die Erwerbs-Bevölkerung weiter sinkt, bis 20235 um 4,2 Mio., und die Digitalisierungsdefizite und Energieabhängigkeit/Verteuerung fortdauern. Die Hoffnungen auf eine Rückkehr zum Wachstum stützen die politischen Eliten und führenden Wirtschaftskreise auf die schuldenfinanzierten Ausgaben für Infrastruktur und vor allem für exorbitante Militärausgaben.
Aber, der sogenannte militärische Keynesianismus, oder auch „Bastard-Keynesianismus“ bezeichnet, der Nachfragesteigerung über Unsummen für Rüstung und Kriegsvorbereitung umfasst, ist als ein Versuch zu werten, staatliche Konjunkturpolitik über Rüstungsaufträge zu betreiben.
Eine massive staatliche Nachfrage nach Waffen und militärischer Infrastruktur kann, wie durch die Bundesregierung beschlossen, kurzfristig die Produktion anregen, sogar Arbeitsplätze sichern und gesamtwirtschaftliches Wachstum vortäuschen. Doch dieser Impuls steigert nicht den gesellschaftlichen Reichtum, sondern kanalisiert Ressourcen in unproduktive Verwendungen. Waffen verschleißen ohne gesellschaftlichen Nutzen und schaffen weder neue Produktionsmittel noch Konsumgüter, die den Lebensstandard erhöhen. Langfristig verschärft somit militärischer Keynesianismus den Widerspruch kapitalistischer Akkumulation: Er stabilisiert Profite durch staatliche Verschuldung, ohne reale Wertschöpfung zu generieren.
Plädoyer für eine sozialistische Wirtschaftspolitik
Aus marxistischer Perspektive ist ein Bruch mit der profitorientierten Akkumulationslogik zwingend erforderlich, um eine bedarfsorientierte, planvolle Produktion unter demokratischer Kontrolle zu etablieren, eine sozialistische Wirtschaftspolitik.
Die Überwindung der Schuldenbremse schafft hierfür fiskalische Spielräume: Simulationen deuten auf einen langfristigen Wachstumsschub durch Investitionen hin, für die nach Schätzungen kritischer Ökonomen ein Investitionsvolumen von 500 Mrd. Euro erforderlich wären. Damit ließe sich der Modernisierungsbedarf in Infrastruktur, erneuerbare Energien, Klimaschutz und Digitalisierung weitgehend abdecken. Finanzierbar wäre dies, so die Vorschläge, mittels Übergewinnsteuer auf Rüstungs- und Energiekonzerne, Vermögensabgabe ab 2 Mio. € sowie einer Enteignung monopolistischer Konzerne gemäß Art. 15 GG. Dies ist verfassungsrechtlich machbar bei Produktionsmitteln mit hinreichender wirtschaftlicher Bedeutung, die elementare gesellschaftliche Bedarfe decken und sozialisierungsreif sind. Das trifft auf Güter wie Nahrung, Wohnraum oder Energie zu.
Die in den vergangenen Monaten auflebende Debatte um Vergesellschaftung von Schlüsselindustrien wie Auto, Chemie und Rüstung, unter Beteiligung von Betriebsräten und Gewerkschaften, orientiert sich an historischen Beispielen wie des IG Metall-Vorschlags Stahl 1983 zur Vergesellschaftung der bundesdeutschen Stahlindustrie. Ein sozial-ökologischer Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft, eine Umrüstung auf öffentlichen Nahverkehr statt einer zeitlosen Fortschreibung gemütsberuhigender Pendler-Pauschalen und Ausbau der erneuerbaren Energien ist für eine lebenswerte Zukunft politökonomisch plausibel und rückverteilungsgerecht.
Vorliegende Studien erbringen zudem den Nachweis, dass in Ergänzung dazu eine Arbeitszeitverkürzung auf 30 Std./Woche volkswirtschaftlich sinnvoll ist und eine emanzipatorische, sozialistisch geprägte Wirtschaftspolitik als Kernelement einer gesellschaftlichen Alternative vorantriebe.
Quellen:
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/11/PD25_418_811.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/01/PD26_019_611.html
https://doku.iab.de/forschungsbericht/2025/fb1225.pdf
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/294177/1/1887983902.pdf
https://www.ey.com/de_de/newsroom/2025/08/ey-industriebarometer-q2-2025
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/deutsche-chemie-kaempft-ums-ueberleben/100179919.html
https://www.candriam.com/de-de/professional/insights/highlighted/outlook-2026/der-ki-goldrausch/
M. Candeias: Das politische Feld nach links verschieben, Luxemburg 2026
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Fokus-Volkswirtschaft/Fokus-2025/Fokus-Nr.-489-Maerz-2025-Arbeitskraefte.pdf
https://www.kommunisten.de/rubriken/kapital-a-arbeit/9374-milliardenueberschuss-zoelle-bremsen-china-nicht
https://www.labournet.de/branchen/stahl/gemeineigentum-als-krisenloesung-vor-40-jahren-startete-die-ig-metall-ihren-anlauf-zur-vergesellschaftung-der-bundesdeutschen-stahlindustrie/
Marxistische Blätter 4/25: KI marxistisch betrachtet, 2025
https://www.sovd.de/fileadmin/bundesverband/pdf/broschueren/wahlen/sovd-forderungen-bundestagswahl2025.pdf
https://www.oecd.org/de/about/news/press-releases/2025/06/global-economic-outlook-shifts-as-trade-policy-uncertainty-weakens-growth.html
https://science.lu/de/science-check/35-stunden-woche-was-weiss-die-wissenschaft-ueber-arbeitszeitverkuerzung
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/73769/umfrage/prognosen-zur-entwicklung-des-deutschen-bip/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/161054/umfrage/beschaeftigte-verarbeitendes-gewerbe/
https://www.statista.com/statistics/1370584/g7-country-gdp-levels/
Geschichte als Waffe (III)
Zur Rolle von Geschichtspolitik für die Erzeugung von Feindbildern
Verfasser: Peter Wahl, Publizist mit Schwerpunkt Internationale Beziehungen, Mitbegründer von Attac Deutschland; Dr. Detlef Bimboes, Mitglied im Gesprächskreis Frieden und Sicherheitspolitik der Rosa Luxemburg Stiftung in Berlin, Arbeiten zu Ostseegeschichte und Energieversorgung
Geschichtspolitik fungiert als ideologisches Instrument, das insbesondere in Konfliktsituationen dazu dient, historische Narrative zur Feindbildkonstruktion und zur Mobilisierung gesellschaftlicher Kriegsbereitschaft zu nutzen.
Teil I
Kernpunkte
Einleitung
Geschichtspolitik vielgestaltig und widersprüchlich
Teil II
Estland 42-mal in 1000 Jahren von Russland angegriffen? – Fake statt Fakten
Systematische Unterwerfung der Esten - zuerst durch Dänen, Schweden und Deutsche
Russische Westerweiterung
Napoleons Feldzug nach Moskau und die polnisch-russische Erbfeindschaft
Polnische Osterweiterung unter Pilsudski
Teil III
Die postrevolutionäre Außenpolitik der UdSSR zur Überwindung der Isolation
Das Scheitern einer Anti-Hitler-Koalition mit den Westmächten 1939
Zur Logik von Geschichtspolitik
Schlussbemerkung
Die postrevolutionäre Außenpolitik der UdSSR zur Überwindung der Isolation
Während die expansionistische Außenpolitik der Pilsudski-Ära im polnischen Selbstverständnis völlig unterbelichtet ist, sind alle Scheinwerfer der Aufmerksamkeit auf den Hitler Stalin Pakt von 1939 gerichtet. Er gilt als die Inkarnation russischer Bösartigkeit und wird auch im geschichtspolitischen Mainstream des Westens gern in das Schema der Totalitarismustheorie eingepasst. Demnach war die Demokratie in Westeuropa der Zwischenkriegszeit innenpolitisch von links und rechts und international durch Faschismus und Sowjetkommunismus gleichermaßen bedroht.[1] Manche gehen sogar so weit, zu behaupten, der Zweite Weltkrieg sei durch den Hitler-Stalin-Pakt erst ermöglicht worden, oder sehen die Hauptverantwortung für das Abkommen bei Moskau. So heißt es z.B. im in der Tageszeitung Die Welt 2021 unter dem Titel Der teuflische Pakt mit dem „Abschaum der Menschheit“, dass „nicht Hitler die treibende Kraft bei diesem Pakt war, sondern Stalin. Die Initiative war von der Sowjetunion ausgegangen.“[2] Vor diesem Hintergrund wollen wir zunächst einen Blick auf die Grundlinien der sowjetischen Außenpolitik 1921 – 1939 werfen.
Nach Ende des Bürgerkriegs war die Außenpolitik Moskaus von den traumatischen Erfahrungen mit den Ergebnissen des Vertrags von Brest-Litowsk, der Intervention ausländischer Großmächte und dem Krieg mit Polen geprägt. Alle außenpolitischen Anstrengungen richteten sich darauf, die Grenzen der Sowjetunion zu sichern, Isolierung und Einkreisung zu verhindern, Krieg abzuwenden, um die Revolution zu konsolidieren und die Erholung und den Aufbau der Wirtschaft und der Infrastrukturen voranzutreiben. Es war die Zeit der ersten Fünfjahrespläne und der Industrialisierung.
Außenpolitisch bedeutete es die Aufgabe des weltrevolutionären Anspruchs der Komintern und - nach dem Scheitern der revolutionären Versuche in Westeuropa – sich mit „Sozialismus in einem Land“ zu begnügen. Dazu notwendig waren diplomatischer Beziehungen mit anderen Staaten, die kurz zuvor noch Feinde waren, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Handelsverträge. Dem diente auch die Suche nach kollektiven Friedens- und Sicherheitssystemen u.a. mit einer Reihe von (bilateralen) Nichtangriffsverträgen.
An erster Stelle steht hier der Rapallo-Vertrag (1922) mit Deutschland, der für beide Länder die internationale Isolierung durchbrach und für wirtschaftliche Zusammenarbeit sorgte. Vom Locarno-Vertrag (1925) für ein europäisches Friedens- und Sicherheitssystem blieb die Sowjetunion ausgeschlossen. Mit ihm sollte Deutschland vor dem Hintergrund des Rapallo-Vertrages wieder näher in das europäische Mächtekonzert eingebunden werden, während Russland draußen gehalten wurde. Dem Briand-Kellogg-Pakt trat die Sowjetunion – nicht zuletzt aus Sorge vor Einkreisung –1928 bei. Das Abkommen hat unabhängig davon große historische Bedeutung, denn erstmals in einem internationalen Abkommen verpflichteten sich die Unterzeichnerstaaten darin, auf Krieg als Mittel zur Lösung von Streitfällen zu verzichten. Vorfristig konnte die Sowjetunion das Abkommen mit den baltischen Staaten, Polen, Rumänien, Türkei und Persien in Kraft setzen. Sie verfolgte damit ein osteuropäisches Sicherheitssystem. Moskau hielt sich mit dem beachtlichen außenpolitischen Erfolg dieses „Moskauer Ostpakts“ auch den Rücken in Sibirien frei, wo ständig eine Intervention Japans drohte.
Die konfliktreiche Beziehung – mit historisch weit zurückreichenden Wurzeln - der Sowjetunion zu England, das damals noch die führende Weltmacht war blieb weiter bestehen. Anders als die englischen Konservativen verfolgte die Labour-Party jedoch eine konziliantere Politik. Sie ermöglichte 1924 die diplomatische Anerkennung der Sowjetunion. Dem folgte eine ganze Reihe weiterer Staaten: das faschistische Italien, Frankreich, Österreich, Griechenland, Norwegen, Schweden, Dänemark und mehrere außereuropäische Staaten.
Nach Beginn der Naziherrschaft sorgte der 1934 abgeschlossene deutsch-polnische Nichtangriffspakt für einen Wendepunkt in den Beziehungen der Sowjetunion mit Deutschland. Da in der Kritik am Hitler-Stalin-Pakt immer ein hohes Maß moralischer Empörung nach dem Motto mitschwingt: „wie kann man nur mit Nazis reden und gar einen Vertrag schließen“, ist doch bemerkenswert, dass Polen bereits fünf Jahre vor dem Hitler-Stalin-Pakt diesen Vertrag mit Nazi-Deutschland abschloss.
Er wurde in Moskau als außerordentlich ernst angesehen, was vor dem Hintergrund der imperialen Expansionsgelüste Pilsudski-Polens durchaus nachvollziehbar ist. Die Sowjetunion versuchte daher noch im gleichen Jahr entgegenzusteuern. So wurde der Nichtangriffsvertrag mit Polen von 1932 verlängert, ebenfalls die Nichtangriffsabkommen mit den baltischen Staaten. Der sowjetische Vorschlag, den deutsch-polnischen Nichtangriffspakt mit einem Ostpaktsystem (sog. Ost-Locarno) zu neutralisieren, scheiterte jedoch. Dem sollten neben der Sowjetunion, Deutschland und Polen die baltischen Staaten und die Tschechoslowakei angehören.
Das Scheitern einer Anti-Hitler-Koalition mit den Westmächten 1939[3]
Die Annäherung zwischen Polen und Nazi-Deutschland und das Scheitern der Ostpaktpläne führten dazu, dass die sowjetische Außenpolitik engere Beziehungen zu den Westmächten suchte. Denn Moskau wurde immer klarer, worauf Hitler zusteuerte. Bereits in „Mein Kampf“ hatte er seine Absichten dargelegt: das bolschewistische System sollte durch einen Eroberungskrieg zerschlagen, von antislawischem Rassismus getragener, neuer „Lebensraum im Osten“ für die Deutschen geschaffen und das Judentum vernichtet werden. Im Kriegsfalle dürfe sich ein Zweifrontenkrieg wie 1914 bis 1917 nicht wiederholen und deshalb sollte ein Bündnis mit England und dem faschistischen Italien ins Auge gefasst werden.
Dies wurde von der sowjetischen Führung natürlich als Bedrohung gesehen. Aber sie existierte auch im Alltagsbewusstsein der Bevölkerung, wie u.a. der oben erwähnte Film Eisensteins über Alexander Newski belegt, der ein geschichtspolitisches Projekt gegen Nazi-Deutschland war.
Um die Beziehungen zu den Westmächten zu verbessern, setzte Stalin durch, dass auch die Kommunistische Internationale (Komintern) nach Hitlers Machtübernahme ihren Kurs änderte. Statt einer engen Klassenpolitik mit kommunistischen Parteien als Avantgarde - phasenweise sogar mit den als „Sozialfaschisten“ etikettierten Sozialdemokraten als Hauptgegner - sollte jetzt die Spaltung der Arbeiterbewegung überwunden werden („Einheitsfront“). Dann wurde dies sogar noch um eine Allianz mit den Liberalen und allen demokratischen Kräften („Volksfront“) und später sogar durch die Strategie der „Nationalen Front“ erweitert.
Selbst DER SPIEGEL - nicht gerade als pro-russisch bekannt - schrieb 2009 „Die Erfolge der Nazis ließen den Männern im Kreml antifaschistische Volksfrontbündnisse, wie sie 1936 in Frankreich und Spanien zustande kamen, als Instrumente zur Erhöhung der ‚kollektiven Sicherheit‘ erscheinen. Gleichzeitig allerdings versuchte Stalin durchaus, die Radikalisierung dieser Volksfronten zu verhindern, um keine Konflikte mit den Westmächten heraufzubeschwören. – die Sicherheit der Sowjetunion hatte für ihn Priorität.“[4]
Dies zeigt, dass die sowjetische Außenpolitik nicht mit dem Maß des Stalinismus zu messen ist, der die innenpolitische Entwicklung des Landes einer brutalen Diktatur unterwarf. Das außenpolitische Verhalten Stalins folgte stattdessen der geopolitischen Logik und den Methoden, wie sie die Außenpolitik auch der westlichen Großmächte charakterisierten. Dass diese weder pazifistischen Idealen noch den völkerrechtlichen Prinzipien folgte, wie sie ein Jahrzehnt später in der UN-Charta formuliert wurden, versteht sich.
Doch der Kurs Russlands führte nicht zur erhofften Wende. Insbesondere England war nicht bereit, mit der Sowjetunion gegen den Hitler-Faschismus zusammenzuarbeiten. So hielt der britische Premierminister Neville Chamberlain die Sowjetunion für militärisch schwach und daher als Bündnispartner gegen Hitler wenig geeignet. Außerdem stand die Überlegung dahinter, „wenn der Status quo sowieso nicht zu halten ist, dann wäre der Faschismus letztlich vielleicht sogar besser als seine Alternative: soziale Revolution und Bolschewismus.“[5] Stattdessen setzten London und Paris auf Beschwichtigungspolitik gegenüber Hitler, die ihren Höhepunkt im Münchener Abkommen 1938 fand, mit dem die Tschechoslowakei gezwungen wurde, das Sudetenland an Deutschland abzutreten.
Spätestens am 18. März 1939, als Hitler die sog. Rest-Tschechei besetzte, wurde deutlich, dass die Beschwichtigungspolitik gescheitert war. Das schuf im April 1939 die Voraussetzungen für Verhandlungen in Moskau zwischen England und der Sowjetunion. Sie bot „in Verhandlungen einen britisch-französisch-sowjetischen Dreibund, unter Umständen mit Einschluß Polens, an. Das Bündnis kommt jedoch trotz langwieriger Verhandlungen nicht zustande“. Am 24. Juli 1939 kommt es dann doch zu einem „Beistandsvertrag zwischen Frankreich, Großbritannien und der Sowjetunion. Er tritt jedoch nicht in Kraft, weil die sich anschließenden Verhandlungen über eine Militärkonvention nicht zur Einigung führen, vor allem wegen der Frage des Durchmarschrechts der Sowjetunion durch Polen und Rumänien“[6].
Knackpunkt war also die sowjetische Forderung nach einem Recht auf Durchmarsch der roten Armee durch Polen, um an die potentielle Front mit der Wehrmacht zu kommen. Das lag auch deshalb im Interesse Moskaus, weil ein Krieg damit von der sowjetischen Grenze ferngehalten würde. Das aber wurde von Polen wiederum strikt abgelehnt.
In der Zwischenzeit aber war die Sowjetunion an ihrer sibirische Grenze mit einem Krieg mit Japan konfrontiert. Anlass war der unklare Grenzverlauf mit dem japanischen Marionettenregime in der Mandschurei. Das mobilisierte in Moskau Ängste vor einem Zweifrontenkrieg, zumal den japanischen Truppen am 31. Juli ein Durchbruch gelungen und die Rote Armee zu einem taktischen Rückzug gezwungen war. Allerdings war die Gegenoffensive dann erfolgreich, und die Japaner wurden am 11. August in der entscheidenden Schlacht am Fluss Chalchin Gol geschlagen. Am 16. September wurde der Konflikt mit einem Waffenstillstand beendet.
Zugleich hatte Deutschland Nichtangriffsverträge mit den baltischen Staaten abgeschlossen, mit Litauen im März 1939, mit Estland am 7. Juni 1939 und mit Lettland am 7. Juli 1939.
Vor dem Hintergrund dieser geopolitischen Gesamtlage nahm Moskau am 15. August das Angebot zu Verhandlungen über einen Nichtangriffspakt an. Am 24. August wurde er von Molotow und Ribbentrop in Moskau unterzeichnet.[7]
Eine Woche später, am 1. September, begann der deutsche Überfall auf Polen und mit ihm der Zweite Weltkrieg in Europa. Allerdings: „Der Pakt war nicht die Ursache für Europas Scheitern, sondern dessen Folge. Er entstand nach jahrelanger Weigerung des Westens, mit Russland eine kollektive Sicherheit aufzubauen.“[8]
Am 17. September besetzte die Rote Armee die im geheimen Zusatzprotokoll mit den Deutschen vereinbarten polnischen Territorien bis grosso modo zur alten Curzon-Linie, sowie die drei baltischen Länder.
Das gesamte Lagebild war in den Vorkriegsmonaten von extremen Turbulenzen geprägt. Entscheidungen mussten unter Bedingungen von Handlungsdruck und Ungewissheit getroffen werden. Auf allen Seiten herrschte Misstrauen, nicht nur aus tiefsitzenden ideologischen Gründen, sondern auch, weil auf allen Seiten mit Geheimdiplomatie und Doppelstrategien gearbeitet wurde.
Für Moskau war der Pakt nach dem Zögern der Westmächte 1939, sich auf eine antifaschistische Allianz einzulassen, die „Defensivmaßnahmen eines Staates, der sich allein auf seine eigenen Kräfte zurückgeworfen sieht. Die sowjetische Politik handelte aus dem Bewusstsein mangelnder militärischer Stärke, das nicht zuletzt durch die Auswirkungen der unlängst stattgehabten Säuberungen der Roten Armee genährt wurde, dem Bewusstsein politischer Isolation … und nicht zuletzt aus der Furcht vor der Möglichkeit einer antisowjetischen Allianz zwischen dem Dritten Reich und seinen westlichen und östlichen Nachbarn.“[9]
Zur Logik von Geschichtspolitik
Anhand unserer Skizze einiger historischer Perioden wurden bereits wesentliche Elemente der Funktionsweise von Geschichtspolitik sichtbar. Neben unverblümten Fakes und Fälschungen bezieht sie ihre Wirkung vor allem durch gedankliche Operationen, die es ermöglichen, unbestreitbare Tatsachen im Nachhinein in eine interessengeleitete Interpretation einzupassen. So sind ja die polnische Teilung im 18. Jahrhundert oder der Hitler-Stalin-Pakt unbestreitbare Tatsachen. Wie aber deutlich wurde, können die polnisch-russischen Beziehungen nicht auf sie reduziert werden. Nur wenn man die ganze Geschichte der wechselvollen Beziehungen zwischen beiden Ländern berücksichtigt, kommt man der Realität nahe. Dann treten an die Stelle scheinbarer Eindeutigkeit Ambivalenz und Widersprüchlichkeit, und moralisierende Ansprüche auf Alleinbesitz der Wahrheit werden brüchig.
Mit anderen Worten: ein zentrales Element jeder Geschichtspolitik ist ihre Selektivität. Vermeintlich ehrenvolle und glanzvolle Epochen werden ausführlich behandelt, dunkle Kapitel kommen dagegen nur kurz vor, werden meist beschönigt, oder mitunter sogar komplett abgestritten oder totgeschwiegen. Es gilt das Prinzip, wie es in einem Churchill zugeschriebenen Bonmot heißt: Zitiere nur das, was Du selbst aus dem Zusammenhang gerissen hast!
Von großer Brisanz ist Geschichtspolitik gegenwärtig im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg. Ein spektakulärer Fall ist Putins Artikel vom Juli 2021 mit dem Titel „Über die historische Einheit von Russen und Ukrainern.“ Darin heißt es gleich im ersten Satz: „Russen und Ukrainer waren ein Volk.“[10] Das wird dann so interpretiert, dass die Ukraine „wieder unter Moskaus Oberhoheit gestellt werden müsse“, so stellvertretend für die Reaktion hierzulande der ukrainische Ex-Außenminister Kuleba.[11] Unabhängig davon, ob die historischen Ausführungen in Putins Artikel im Einzelnen zutreffen, ist zum einen die Formulierung „waren ein Volk“ und alles was er sonst dazu sagt eindeutig Vergangenheitsform. Wichtiger aber noch ist, dass es am Schluss des Artikels heißt: „Wir respektieren den Wunsch der Ukrainer ihr Land frei, sicher und wohlhabend zu sehen.“ Das wurde in der selektiven Berichterstattung unterschlagen.
Die internationalen Beziehungen sind jedoch ein Wechselspiel von Aktion, Reaktion, Reaktion auf die Reaktion usw. Die Art der Aktion und Reaktion wird geprägt von den Kräfteverhältnissen zwischen den Akteuren, die sich wiederum aus den Machtressourcen – Militär, ökonomische und technologisches Potential, politischer Einfluss, Soft Power etc. – ergeben. Der Nachteil einer differenzierten, realitätsgerechten Betrachtung ist aber leider, dass sie komplizierter ist, Sachkenntnis erfordert und daher schlecht für Propagandazwecke taugt.
Ganz anders dagegen der Bruch mit der Nazi-Ära[12], und - wenn auch nicht so radikal - im Vergleich mit der Zeit nach der Wiedervereinigung. Das heißt: Geschichte kennt auch Phasen dramatischer Umbrüche. Die extremsten Fälle sind oft mit Revolution oder Krieg verbunden.
Von daher ist es grundsätzlich ein Irrweg, über lange Zeiträume hinweg eine Kontinuität eines Landes und ein gleichbleibendes Selbstverständnis oder Identität seiner Bevölkerung zu konstruieren. Die Esten, Polen, Russen, Deutschen usw. von heute sind sich untereinander ungeachtet ihrer Unterschiede viel näher und ähnlicher als gegenüber ihren jeweiligen Vorfahren vor tausend Jahren. Denn „das menschliche Wesen ist kein dem einzelnen Individuum inwohnendes Abstraktum. In seiner Wirklichkeit ist es das ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse.“[13]Und das „ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse“ ist heute nun einmal total anders als vor tausend Jahren.
Schon rein sprachlich würden heutige Deutsche ihre Vorfahren von vor tausend Jahren nicht verstehen: „Ik gihorta đat seggen, đat sih urhettun ænon muotin, hiltibraht enti hađubrant, untar heriun tuem sunufatarungo. iro saro rihtun, garutun se iro guđhamun, gurtun sih iro suert ana, helidos, ubar hrina“, wie dieser althochdeutsche Satz aus dem Hildebrandlied zeigt. Ganz zu schweigen von einer Geschichtspolitik, die heutige territoriale Ansprüche aus dem Alten Testament ableitet, wie die israelische Regierungspartei Likud, in deren Gründungsprogramm es schon 1977 heißt, dass man „Judäa und Samaria keiner ausländischen Verwaltung übergeben" werde, denn: „Zwischen dem Meer und dem Jordan wird es nur israelische Souveränität geben" [14]
All das heißt natürlich nicht, dass Geschichte bedeutungslos wäre. Je kürzer eine Ära zurückliegt, umso mehr Einfluss hat sie auf eine aktuelle Situation. Es bestehen dann Pfadabhängigkeiten, die nicht ohne Weiteres und schnell verschwinden oder beseitigt werden können. Je weiter man jedoch in der Geschichte zurückgeht, um so dünner werden die Kontinuitäten, um sich dann spätestens nach drei, vier Jahrhunderten ganz aufzulösen.
Schlussbemerkung
Unser Streifzug durch die Geschichte hat - wir unterstreichen das noch einmal ausdrücklich - nicht die Absicht, der Geschichtspolitik der Osteuropäer und generell des Westens gegenüber Russland ein spiegelbildliches Narrativ entgegenzusetzen, in dem dann Russland als „die Guten“ und in einer Opferrolle erscheint. Russland ist eine Großmacht, in Sachen strategischer Atomwaffen auch eine Supermacht auf Augenhöhe mit den USA, und folgt den Verhaltensmustern einer Großmacht.[15]
Worauf es uns ankam, war deutlich zu machen, dass Geschichtspolitik eine ideologische Konstruktion ist, die in Konfliktsituationen dazu beiträgt, Spannungen anzuheizen und Kriegsbereitschaft in den eigenen Reihen zu fördern. Gerade im akuten Konflikt mit Russland ist das ein massives Problem.
Demgegenüber ist ein nüchterner, unparteiischer Blick auf Geschichte erforderlich. Das ist nicht einfach, angesichts der Widersprüchlichkeit und Komplexität der realen Geschichte. Daher sind die Vereinfacher, die Geschichte auf widerspruchsfreie Schwarz-Weiß-Bilder und süffige Klischees reduzieren im Vorteil. Denn wer kennt sich schon in Geschichte aus? Und vor allem, wer blickt auf sie mit dem nötigen skeptischen Wissen um die Fallstricke, in denen man sich verheddern kann?
Aber angesichts der existentiellen Bedeutung von Krieg und Frieden führt kein Weg daran vorbei, sich dem zu stellen.
[1] Die Theorie erlebt in jüngster Zeit mit dem Aufstieg der neuen Rechten und der Interpretation der internationalen Spannungen als
Gegensatz von Auto-und Demokratie in Form der sog. Hufeisentheorie wieder ein Revival.
[2] Kellerhoff, Sven-Felix: Der teuflische Pakt mit dem „Abschaum der Menschheit“, in: Welt vom 07.04.2021
[3] Ausführlich zum Hitler-Stalin-Pakt siehe u.a.:
Carley, Michael Jabara (2009): 1939: The Alliance That Never Was and the Coming of World War II. Chicago
Hass, Gerhard (190): 23. August 1939. Der Hitler-Stalin-Pakt, Berlin
Koch, Christoph (Hg.)(2015): Gab es einen Stalin-Hitler-Pakt? Charakter, Bedeutung und Deutung des deutsch-sowjetischen
Nichtangriffsvertrags vom 23. August 1939, Frankfurt/M.
[4] Piper, Ernst: Hitler-Stalin-Pakt -- Bündnis des Bösen, in: Der Spiegel, 21.08.2009
[5] Hobsbawm, Eric: (1995): Das Zeitalter der Extreme – Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts. München/Wien. S. 201
[6] Der Große Ploetz, S. 751, 32., neu bearbeitete Auflage, Freiburg i. Brsg. 2000
[7] Der eigentliche Vertrag, sah als wesentlichen Kern Neutralität im Fall eines Krieges mit Dritten vor. Hitlers Intention war es, sich damit
freien Rücken für die bereits vorbereiteten Kriege zuerst mit Polen und dann mit Frankreich zu verschaffen, während Stalin hoffte, damit
eine Allianz zwischen den Westmächten und Deutschland zu verhindern. Darüber hinaus gab es ein geheimes Zusatzprotokoll, das die
Grenzen für den Fall einer territorialen Neuaufteilung der Region festlegte.
[8] Sachs, Jeffrey (2025): Warum Feindschaft mit Russland Europa immer ins Unglück gestürzt hat. In: Berliner Zeitung 13.12.205
[9] Koch, Christoph (2015): Der sogenannte Stalin-Hitler-Pakt – monströses Eingeständnis oder lauerndes Misstrauen? In: Derselbe (Hg.): Gab
es einen Stalin-Hitler-Pakt? Frankfurt/M.
[10] Article by Vladimir Putin: On the Historical Unity of Russians and Ukrainians. July 12, 2021
http://en.kremlin.ru/events/president/news/66181
[11] Kuleba Dmytro (2025): The Delusions of Peacemaking in Ukraine. Kyiv Won’t Compromise on Its Sovereignty Because It Isn’t Facing
Defeat. In: Foreign Affairs; May 30, 2025
[12] Der zwar nicht vollkommen abrupt war, wie die Kontinuität von Nazi-Personal in den Eliten und Institutionen und manche Einstellungen in
der Bevölkerung zeigten, aber mit 1968 doch weitgehend zum Ende kam.
[13] Marx, Karl: Thesen über Feuerbach. In: Marx/Engels Werke. 1979, Berlin. Bd. 3, S. 6;
[14] Bayrischer Rundfunk (online), 10.07.2024.
https://www.br.de/nachrichten/bayern/from-the-river-to-the-sea-palestine-will-be-free-woher-kommt-der-umstrittene-slogan,UI2Pxht
Die biblischen Namen Judäa und Samaria stehen für das heutige Westjordanland.
[15] Ausführlicher dazu s. Wahl, Peter/Crome, Erhard/Deppe, Frank/Brie, Michael (2025): Weltordnung im Umbruch. Krieg und Frieden in
einer multipolaren Welt. Köln. Insbes.:S. 11 ff. und 47 ff.
https://www.isw-muenchen.de/online-publikationen/texte-artikel/5396-geschichte-als-waffe Teil 1
https://www.isw-muenchen.de/online-publikationen/texte-artikel/5398-geschichte-als-waffe-ii Teil 2
Militär und Ökonomie (IV)
Grönland im Fokus
Quadriga 2026: Deutschland probt die Kriegslogistik
Geschichte als Waffe (II)
Zur Rolle von Geschichtspolitik für die Erzeugung von Feindbildern
Verfasser: Peter Wahl, Publizist mit Schwerpunkt Internationale Beziehungen, Mitbegründer von Attac Deutschland; Dr. Detlef Bimboes, Mitglied im Gesprächskreis Frieden und Sicherheitspolitik der Rosa Luxemburg Stiftung in Berlin, Arbeiten zu Ostseegeschichte und Energieversorgung
Geschichtspolitik fungiert als ideologisches Instrument, das insbesondere in Konfliktsituationen dazu dient, historische Narrative zur Feindbildkonstruktion und zur Mobilisierung gesellschaftlicher Kriegsbereitschaft zu nutzen.
Teil I
Kernpunkte
Einleitung
Geschichtspolitik vielgestaltig und widersprüchlich
Teil II
Estland 42-mal in 1000 Jahren von Russland angegriffen? – Fake statt Fakten
Systematische Unterwerfung der Esten - zuerst durch Dänen, Schweden und Deutsche
Russische Westerweiterung
Napoleons Feldzug nach Moskau und die polnisch-russische Erbfeindschaft
Polnische Osterweiterung unter Pilsudski
Teil III
Die postrevolutionäre Außenpolitik der UdSSR zur Überwindung der Isolation
Das Scheitern einer Anti-Hitler-Koalition mit den Westmächten 1939
Zur Logik von Geschichtspolitik
Schlussbemerkung
Estland 42-mal in 1000 Jahren von Russland angegriffen? – Fake statt Fakten
Den eingangs zitierten Worten des Europaabgeordneten Rihas, wonach er Estland in den letzten tausend Jahren 42-mal von Russland angegriffen wähnt, soll hier etwas genauer auf den Zahn gefühlt werden. Wir wollen an einem ersten Beispiel zeigen, wie Geschichtspolitik konkret funktioniert.
Vor tausend Jahren gab es so etwas wie Estland nicht. Die Bewohner auf dem Territorium des heutigen Estlands waren stammesgesellschaftlich organisierte, lose verbundene Gemeinschaften von Bauern und Fischern. Staatlichkeit als organisierte Vergesellschaftung über den Stammesverband hinausgehend gab es nicht, genauso wenig wie ein dementsprechend durch klare Grenzen definiertes Territorium. Die estnischen Stämme waren linguistischen und genetischen Studien[1] zufolge mit anderen finno-ugrischen[2] Ethnien ca. 2.500 vor Chr. vom Ural und Sibirien her eingewandert. Untereinander führten sie - wie auch andere Stammesgesellschaften in dieser Entwicklungsstufe – immer mal wieder Krieg – auch untereinander. Kriegsgefangene wurden als Sklaven gehalten, und es hatten sich Ansätze sozialer Differenzierung mit dem Entstehen einer Oberschicht herausgebildet.[3] Mitunter kam es auch zu Überfällen durch Wikinger. In einem Standardwerk über die Geschichte des Baltikums heißt es: „Schon vor und besonders während der Wikingerzeit fielen Schweden und Dänen mit dem Ziel des Raubes und der Tributerpressung im Baltikum ein“.[4] Die religiösen Vorstellungen waren polytheistisch mit einem Obergott, wie es bei den Germanen Wotan war, und es gab die animistische Verehrung von Bäumen, Steinen u. ä.
In diesem Kontext kam es 1031 dann tatsächlich zu einem Konflikt zwischen einem estnischen Stamm und ostslawischen Rittern unter Führung von Jaroslaw dem Weisen, als dieser eine Holzfestung in Dorpat (heute Tartu) im Südosten des heutigen Estlands besetzte bis sie 1060 wieder vertrieben wurden. Möglicherweise hatte unser Europaabgeordneter dieses Ereignis im Kopf.
Die Sache hat aber einen Haken: Jaroslaw war Großfürst von Kiew. Und so wie unser Ex-Generalstabschef eine tausendjährige Kontinuität estnischer Geschichte konstruiert, so reklamiert ihrerseits die nationalistische Geschichtsschreibung der Ukraine für sich eine historisch Kontinuität aus dieser Epoche, um daraus eine auf tausend Jahre gegründete, nationale Identität konstruieren.
Würde man das ernst nehmen, könnte man behaupten, 1031 wäre es die Ukraine gewesen, die Estland angegriffen hat. Schließlich kam Jaroslaw aus Kiew. Das ist natürlich genauso unsinnig, wie eine Zuschreibung an Russland, von dem ein Teil seines heutigen Territoriums damals Teil der Kiewer Rus war. Das wäre so, als wenn Italien den Deutschen vorwerfen würde, dass germanische Stämme im Jahr 9 v.Chr. die römischen Truppen im Teutoburger Wald überfallen und vernichtet hätten. Solche absurden Vorstellungen galten in der Tat auch in den Hochzeiten des deutschen Nationalismus‘. Als dieser im 19. Jhdt. seinen verhängnisvollen Aufstieg begann, wurde ein Kult um den damaligen Anführer der Germanen, Hermann der Cherusker, betrieben. Es gab Denkmäler, wie das Monstrum im Teutoburger Wald - noch heute vom ICE aus zu sehen - Theaterstücke, wie Die Hermannsschlacht von Kleist, populäre Trinklieder („Als die Römer frech geworden…“) u.v.a.m.
Aber zwischen dem Imperium Romanum und dem Italien von heute besteht ein ebenso kategorialer Unterschied wie zwischen dem heutigen Russland und der Kiewer Rus, oder zwischen estnischen Stämmen im 11. Jhdt. und dem Estland unserer Tage.
Hinzu kommt, dass die estnischen Stämme in jener Epoche nicht nur Opfer von Angriffen waren, sondern auch Täter. Denn sie „unternahmen aber auch Gegenschläge … was ebenso für die Litauer gilt, die seit dem späten 12. Jahrhundert sogar sehr oft ihrerseits in die nordwestrussischen Länder einfielen.“[5] Würde man das Geschichtsbild unseres EP-Abgeordneten teilen, könnte man sagen, dass auch dem modernen Estland das Überfallen anderer Länder nicht fremd ist: schließlich war Estland Teil der US-geführten ‚Koalition der Willigen‘, die 2003 den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen den Irak durchführte. Militärisch war der estnische Anteil daran zwar marginal, aber moralisch und völkerrechtlich besteht kein Unterschied zu den anderen Aggressorstaaten[6].
Im Folgenden skizzieren wir den weiteren Gang der russisch-estnisch/baltischen und russisch-polnischen Beziehungen. Dabei geht es nicht um ein detailliertes Bild, und schon gar nicht darum ein wiederum geschichtspolitisches Gegennarrativ zugunsten Russlands zu zeichnen. Natürlich gab es die Westexpansion von Zar Peter I., die russische Beteiligung an den Polnischen Teilungen, den Hitler-Stalin-Pakt oder 1968 den russischen Einmarsch in Prag. Doch das ist nur ein Teil der Wahrheit. Wir wollen auch auf andere Seiten aufmerksam machen und zeigen, dass die reale Geschichte viel komplexer und widersprüchlicher verlaufen ist, als es nationalistischen Erzählungen mit ihrer simplen Schwarz-Weiß-Malerei wahrhaben wollen.
Systematische Unterwerfung der Esten - zuerst durch Dänen, Schweden und Deutsche
Ziel systematischer, dauerhafter Unterwerfung wurden die Stämme auf dem Gebiet des heutigen Estlands tatsächlich schon vor fast tausend Jahren. Aber ganz und gar nicht durch Russen, sondern bis ins 15. Jahrhundert hinein von Dänen, Schweden und Deutschen. 1194/95 erklärte Papst Coelestin III. den ersten livländischen[7] Kreuzzug. Dänische Ritter etablierten 1219 ein erstes Herzogtum Estland[8] auf einem Teil des heutigen Estland, und ein aus Bremen stammender Bischof gründete 1201 Riga, die Hauptstadt des heutigen Lettland.
Daraus sollte sich dann der Deutschordensstaat entwickeln, der sich 300 Jahre später nach mehreren militärischen Niederlagen gegen Polen-Litauen auflöste. Parallel zur gewaltsamen Osterweiterung des Ritterordens kam es im Zuge der sog. deutschen Ostkolonisation zur Einwanderung von Deutschen, die als Kaufleute und Handwerker in die entstehenden Städte zogen. Sie stellten bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Mehrheit der städtischen Bevölkerung und waren für die herrschenden Klassen des Ordensstaates und dessen Nachfolger zugleich eine Absicherung von unten.
Die ethnischen Esten lebten als unterjochte Bevölkerung vorwiegend auf dem Land und arbeiteten in der Agrarwirtschaft. 1400 führte der Ritterorden sogar die Leibeigenschaft ein, und die estnischen Bauern wurden fortan von vorwiegend deutschen Gutsherren ausgebeutet.
Staatlichkeit in Estland war deshalb immer die Staatlichkeit der nicht-estnischen herrschenden Klassen – und das bis zum Ende des ersten Weltkriegs.
Als der Ritterorden im Zuge seiner Osterweiterung im 11. Jahrundert wiederholt versuchte, seine Herrschaft auf das Gebiet der Rus auszudehnen, dabei die russische Handelsstadt Pskow eroberte und nach (Alt-)Nowgorod vorstieß, kam es 1240 zur legendären Schlacht auf dem zugefrorenen Peipussee.[9] Unter Führung von Alexander Newski, Fürst von Nowgorod und Großfürst von Kiew, erlitt der Deutsche Ritterorden eine Niederlage und musste fortan die Osterweiterung einstellen.
„Alexander Newski ist im russischen Geschichtsbewusstsein zum Symbol einer erfolgreichen Verteidigung Russlands gegen Angriffe aus dem Westen geworden.“[10] Die orthodoxe Kirche hat ihn gar zum Heiligen erklärt. Zudem steht er für eine bis heute in Russland verbreitete Bedrohungswahrnehmung: die Umzingelung durch Feinde von allen Seiten. Denn 1223 hatten mongolische Eroberer (Goldene Horde) der Kiewer Rus eine schwere Niederlage beigebracht. In den Folgejahren stand die Rus bis 1502 unter Vorherrschaft der Mongolen. Allerdings tolerierten diese, anders als die westlichen Kreuzzügler, die kulturelle Eigenständigkeit der unterworfenen Russen, einschließlich der orthodoxen Kirche.
Die Newski-Periode nimmt in der russischen Geschichtspolitik eine Schlüsselstellung ein. So heißt z.B. der Prachtboulevard von Petersburg Newski-Prospekt, und seit der Zarenzeit wird der Newski-Orden an hochverdiente Russen verliehen.[11] Der sowjetische Filmpionier Sergej Eisenstein (Panzerkreuzer Potemkin) drehte 1938 einen Historienfilm über Newski und die Schlacht auf dem Peipussee, Prokofjew komponiert die Musik dazu.[12] Das sollte natürlich gegen die damals drohende Gefahr aus dem Westen, Nazideutschland, mobilisieren.
Geschichtspolitik kann, wie dieser Fall zeigt, nicht nur verwerflichen Interessen dienen, sondern ggf. auch eine gewisse Legitimität beanspruchen.
Russische Westerweiterung
Von systematischen Versuchen russischer Expansion in Richtung Baltikum kann man ab Mitte des 16. Jahrhunderts mit dem Ersten Nordischen Krieg sprechen. Durch die Mongolenherrschaft war die Kiewer Rus zerfallen, und das Zentrum ostslawischer Staatlichkeit war von Kiew auf Moskau übergegangen. Ende des 15. Jahrhunderts endete die Mongolenherrschaft. Unter Iwan IV. (der „Schreckliche“, 1530-1584) begann dann die Expansion Russlands zunächst nach Osten, zum kaspischen Meer und dann nach Sibirien.
Schweden war unterdessen zur Großmacht in der Ostsee aufgestiegen. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts wurden Polen und Litauen zu einem Königtum. Damit war ein weiteres Machtzentrum entstanden, das von nun an ebenfalls im Ostseeraum mitmischte, während der Ordensstaat in Auflösung übergegangen war.
Jetzt war die Ostseeregion zu einem Brennpunkt der Großmachtauseinandersetzung zwischen Russland, Polen-Litauen und Schweden geworden. 1558 marschierte Iwan IV. in Livland ein und es kam zum Krieg mit Schweden und Polen-Litauen, der 1583 mit einer russischen Niederlage endete. Russland verlor dadurch einen beträchtlichen Teil seines Territoriums an Polen-Litauen, und Schweden blockierte durch die Besetzung von Ingermanland[13] für die folgenden 150 Jahre den Zugang Russlands zur Ostsee. Der Norden des heutigen Estland wurde direkt der schwedischen Krone unterstellt, Livland kam unter polnisch-litauische Kontrolle.
Nach dem Tod Iwans begann die sog. „Zeit der Wirren“ mit Staatszerfall und Bürgerkrieg. Polen-Litauen ergriff die Gelegenheit beim Schopf und besetzte für zwei Jahre (Juli 1610 bis Oktober 1612) Moskau. Im Gegensatz zu Napoleons Feldzug 200 Jahre später, ist das im Westen - und auch in Polen – kaum bekannt. Dagegen spielt diese Periode in der russischen Geschichtspolitik bis heute eine Rolle. Sie ist u.a. Anlass für einen nationalen Feiertag (4. November). Im Bewusstsein kulturinteressierter Russen ist sie auch deshalb präsent, weil Alexander Puschkin darüber ein Drama geschrieben hat. Auch Mussorgskys Meisterwerk Boris Godunow (1869) hat die Ereignisse zum Gegenstand und zeichnet eine polnisch-russische Feindschaft.[14]
Ein Zweiter Nordischer Krieg (auch Kleiner Nordischer Krieg) begann 1655 mit einem Angriff Schwedens auf Polen-Litauen. Dieser Krieg nahm eine verwirrenden Verlauf mit wechselnden Allianzen, an dem die Habsburger, die Niederlande und Brandenburg und der osmanische Khan der Krim teilnahm. Am Ende dieses paneuropäischen Konflikts standen aber grosso modo wieder die gleichen Verhältnisse wir vor dem Krieg. Das gilt auch für einen russisch-polnischen Krieg 1656-58, der ebenfalls am status quo ante nichts änderte.
Wie wir sehen, unterschied sich die blutige Geschichte Osteuropas damals nicht vom Westen des Kontinents, wo im gleichen Jahrhundert z.B. der Dreißigjährige Krieg tobte (1618 – 1648).
Eine tiefgreifende und lang gültige Veränderung gab es erst mit dem Ausgang des Dritten Nordischen Krieges, der 1700 mit einem Angriff einer Allianz aus Polen und Russland – auch das gab es! - und Dänemark gegen die Schweden begann. Schweden erlitt eine entscheidende Niederlage gegen Russland unter Peter I.[15] Sie besiegelte das Ende Schwedens als Großmacht. Das gesamte Baltikum, also auch Estland fiel an Russland. Daran änderte sich bis zum Ende des Ersten Weltkriegs nichts mehr.
Napoleons Feldzug nach Moskau und die polnisch-russische Erbfeindschaft
Eine wichtige Periode in den Beziehungen Russlands zum Westen ist Napoleons Feldzug nach Moskau 1812. In allen russische Lehrplänen ist dazu Tolstois Roman „Krieg und Frieden“ Pflichtlektüre. Die große Rolle, die dieser Krieg im russischen Selbstverständnis spielt, wird nur durch die noch frischere Erinnerung an den Vernichtungskrieg Nazi-Deutschlands übertroffen.
Im Gegensatz zu den im vorigen Kapitel skizzierten Epochen sind die Besetzung Moskaus durch Napoleon und sein grandioses Scheitern auch im Westen ziemlich bekannt, nicht zuletzt durch mehrfache Verfilmungen von Tolstois Roman, darunter auch aus Hollywood. Wir beschränken uns deshalb auf die Erwähnung eines wenig bekannten, für unser Thema aber relevanten Aspekts: Napoleons Grande Armée war eine multinationale, europäische Armee. Denn zum einen mussten die von Frankreich abhängigen Staaten Truppenkontingente stellen – von Portugal über Spanien, Italien, der Schweiz bis zu den im Rheinbund zusammengeschlossenen 39 deutschen Ländern.[16] Selbst das nicht im Rheinbund vertretene Preußen musste 20.000 Mann beisteuern. Hinzu kam im Rahmen eines Bündnisabkommens mit der Habsburger Monarchie ein Armeekorps von 30.000 Mann, das zwar unter dem Kommando Wiens stand, sich aber gleichwohl am Einmarsch nach Russland beteiligte.
Wenn in unseren Tagen im Kontext des Ukrainekrieges in Paris und London die Stationierung von Truppen europäischer NATO-Länder in der Ukraine erwogen wird – quasi eine NATO-light - und damit die Konfrontation mit Moskau über das Ende des Krieges hinaus verlängert wird, dürfte das unschöne Erinnerungen in Russland wecken.
Für das polnisch-russische Verhältnis ist zudem von besonderem Interesse, dass die Polen mit ca. 100.000 Mann das größte nicht-französische Kontingent der Grande Armée stellten. Die starke Beteiligung von Polen am Feldzug gegen Russland ist Teil der schon in den vorigen Kapiteln erwähnten, langen Konfliktgeschichte zwischen beiden Ländern. Die in den Jahren zuvor erfolgte Aufteilung Polens zwischen Preußen, Österreich und Russland hatte viele Polen dazu motiviert, an der Seite Frankreichs zu kämpfen.
Die polnisch-russischen Beziehungen tragen viele Züge, wie wir sie aus der deutsch-französischen Erbfeindschaft kennen. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang zweierlei:
· obwohl Deutschland und Frankreich schon immer Nachbarn sind, zeigte die wechselseitige Feindseligkeit, dass das Bild miteinander verfeindeter Nachbarn keineswegs auf realistischer Kenntnis des anderen beruhte, sondern durch Ressentiment und Hass total verzerrt war. Ähnliches dürfte für die Behauptung von Polen (und Balten), man kenne Russland besser als andere, zutreffen;
· die deutsch-französische Erbfeindschaft verschwand nach dem Zweiten Weltkrieg schlagartig. Das zeigt: Erbfeindschaft ist nicht naturgegeben, sondern abhängig von politischem Willen der Akteure.
·
Polnische Osterweiterung unter Pilsudski
In den Beziehungen des Baltikums zu Russland kam mit Ende des ersten Weltkriegs zu einem tiefen Einschnitt: so erhielten Estland, Lettland und Litauen als Nebeneffekt des Vertrags von Brest-Litowsk, den Sowjetrussland im März 1918 mit dem wilhelminischen Deutschland zähneknirschend schließen musste, ihre Unabhängigkeit. Die Sowjets mussten auch die Ukraine und Finnland als selbständige Staaten anerkennen. Auch Polen erhielt am 11.November 1918, zeitgleich mit dem Waffenstillstand in Compiègne seine Unabhängigkeit. Die Ukraine wurde dann aber im Bürgerkrieg größtenteils wieder zurückerobert.
Die mit dem Brest-Litowsker Friedensvertrag verbundene Schwäche Sowjetrusslands und die nachrevolutionären Konflikte führten zu diesem Bürgerkrieg, der bis 1921 dauerte. Es war ein äußerst blutiger und brutaler Krieg. Verschlimmert wurde er dadurch, dass auch noch ausländische Großmächte intervenierten. „Von 1918 bis 1920 schickten die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich und Japan Tausende Soldaten – über das Baltikum, Nordrussland, Sibirien und der Krim – und gaben Millionen von Dollars und Waffen an die anti-kommunistischen Weißen; ein gescheiterter Versuch den Bolschewismus im Keim zu ersticken.“[17] Allein die Briten setzten 60.000 Mann ein, und operierten von Murmansk im Norden und Baku im Süden aus. Die USA landeten Truppen in Archangelsk und an der Pazifikküste. Japan besetzte Wladiwostok, und französische Truppen drangen vom Schwarzen Meer aus nach Odessa und Cherson vor.
Auch Polen ergriff die Gelegenheit beim Schopf, marschierte 1920 in der Ukraine ein und besetzte am 7. Mai 1920 Kiew. Staatschef Pilsudski akzeptierte nämlich nicht die in den Versailler Verträgen festgelegte Curzon-Linie (benannt nach dem damaligen britischen Außenminister) als polnische Ostgrenze. Polen wollte wieder zu alter Größe von vor der Teilung 1772 zurückkehren. Das wäre eine Grenze entlang des Dnjepr gewesen. Ziel war die Schaffung einer Konföderation mit Litauen, Weißrussland und der Ukraine unter polnischer Führung. Allerdings gelang es der roten Armee, die Polen nicht nur aus der Sowjet-Ukraine zu vertreiben, sondern bis kurz vor Warschau vorzustoßen. Dann wendete sich das Blatt aber, und die russischen Truppen wurden wieder zurückgeschlagen.
Mit einem Siegfrieden für Polen wurde der Krieg 1921 im Vertrag von Riga im März 2021 beendet, und Polen genehmigte sich eine Osterweiterung um bis zu 250 Kilometer östlich der Curzon-Linie auf sowjetisches Territorium in Weißrussland und der Ukraine. Die neue Grenze hielt bis 1939, als Moskau auf Grundlage des Hitler-Stalin-Pakts die Curzon-Linie wiederherstellte.
Ein interessanter Aspekt des polnisch-sowjetischen Kriegs besteht darin, dass er ein Leitmotiv im polnischen Selbstverständnis aus den Angeln hebt: seit den polnischen Teilungen gibt es in Polen die Vorstellung, das Land sei immer Opfer benachbarter Großmächte, insbesondere aber von Russland gewesen. Einer Umfrage von 2019 zufolge glauben 74 Prozent der Befragten, dass die polnische Nation mehr gelitten hat als andere.[18] Entstanden ist der Opfermythos in der Romantik. So meinte der Nationaldichter Adam Mickiewicz (1798 -1855), Polen sei „der Christus der Nationen.“ Und noch 2016 sagte der damalige Verteidigungsminister Antoni Macierewicz: „Dieses unglaubliche Martyrium, das es nirgendwo sonst auf der Welt gibt, dieser Versuch, eine große europäische Nation durch das Zusammenspiel zweier Weltmächte und das Schweigen und den Verrat unserer eigenen Verbündeten auszulöschen - all das wurde durch die Kraft des großen polnischen Geistes, die Kraft unserer nationalen Tradition, die Kraft unseres Glaubens überwunden, die uns sagte, niemals aufzugeben oder zu kapitulieren.“[19]
Wie wir an dem polnisch-sowjetischen Krieg und den Großmachtgelüsten Polens in dieser Zeit sehen, kann aus einem Opfer sehr schnell ein Täter werden sobald die Machtressourcen dazu vorhanden sind und die Umstände es erlauben.
Um das Bild zu vervollständigen: im Oktober 1920 besetzte polnisches Militär auch die litauische Hauptstadt Wilna und weitere Gebiete Litauens, um im März 1922 auch formell 37.000 Quadratkilometern litauischen Territoriums mit ca. einer Million Einwohnern zu annektieren.[20]Und genauso wenig passt in den polnischen Opfermythos 16 Jahre später, dass Polen einen Tag, nachdem die Wehrmacht auf Grundlage des Münchener Abkommens ins Sudetenland einmarschierte (1. Oktober 1938) die Gelegenheit nutzte und selbst Truppen in das Gebiet des zur Tschechoslowakei gehörenden Gebiets Teschen an der Olsa schickte und es annektierte.
https://www.isw-muenchen.de/online-publikationen/texte-artikel/5396-geschichte-als-waffe Teil I
[1] Saag, Lehti/Laneman, Margot, Khartanovich/Valeri I. et al. (2019): The Arrival of Siberian Ancestry Connecting the Eastern Baltic to Uralic
Speakers further East. In: Current Biology 29, 1701–1711, May 20, 2019. Cambridge Massachusetts
[2] Die estnische Sprache gehört, anders als die anderen Sprachen im Baltikum, zur finno-ugrischen Sprachfamilie, zu der auch das Ungarische
und das Finnische gehören.
[3] Angermann, Norbert/Brüggemann, Karsten (2021): Geschichte der baltischen Länder. Stuttgart; S. 19
[4] Ebenda, S.20
[5] Ebenda S. 21
[6] Darunter übrigens auch die Ukraine, die das sechstgrößte Kontingent (von 36) in der ‚Koalition der Willigen‘ stellte.
[7] Als Livland wurde damals das Gebiet ungefähr der heutigen Staaten Estland und des größten Teil Lettlands bezeichnet.
Der Name kommt von den Liven, einem ebenfalls finno-ugrischen Stamm.
[8] Erstes Herzogtum Estland deshalb, weil es 1561 bis 1721 unter schwedischer Herrschaft ein zweites Herzogtum Estland gab.
[9] Der Peipussee bildet auch heute wieder die Grenze zwischen Estland und Russland.
[10] Alexander, Manfred/Stökl, Günther (2009): Russische Geschichte. Stuttgart
[11] Die Bolschewiki hatten ihn zunächst für ein paar Jahre abgeschafft, Stalin führt ihn wieder ein.
[12] Der Film ist auf youTube verfügbar: https://www.youtube.com/watch?v=Gq4PaJfod4w
[13] Ingermanland entspricht der heutigen Region Petersburg und dem Oblast Leningrad mit dem Fluss Narwa
und dem Peipussee als Westgrenze.
[14] So heißt es z.B. an einer Stelle, die am polnischen Königshof spielt: „Bald wird unser sein das Reich der Moskowiter. Werden die Barbaren
bald gefangen nehmen! Ihre Kriegesheere werden bald wir treten, siegreich in den Staub.“ (Dritter Aufzug, zweites Bild). Das ist wohl-
gemerkt die Sichtweise des Russen Mussorgsky, die aber den Polen ein Überlegenheitsdenken gegenüber den „moskowitischen Barbaren“
zuschreibt.
[15] Die entscheidende Schlacht fand übrigens bei Poltawa in der heutigen Ukraine statt.
[16] Darunter Bayern, Württemberg, Baden, Hessen-Nassau, Hessen-Darmstadt, Westfalen, Sachsen, Mecklenburg-Schwerin.
[17] Bunzel, Theodore (2024): The Big Lesson From the West’s Last Invasion of Russia. What the Allied intervention in the Russian civil war
teaches us about Ukraine today. In: Foreign Policy, March 3, 2024
[18] Oko.pres, 13. 7. 2019.
https://oko.press/polacy-wycierpieli-najwiecej-ze-wszystkich-narodow-swiata-tak-uwaza-74-proc-badanych-pola kow/
[19] ebenda
[20] Alexander, Manfred (2008): Kleine Geschichte Polens. Stuttgart; S. 280
Gewaltfreie, soziale Verteidigung im Rahmen einer (hypothetischen) Besetzung Grönlands
Geschichte als Waffe
Zur Rolle von Geschichtspolitik für die Erzeugung von Feindbildern
Verfasser: Peter Wahl, Publizist mit Schwerpunkt Internationale Beziehungen, Mitbegründer von Attac Deutschland; Dr. Detlef Bimboes, Mitglied im Gesprächskreis Frieden und Sicherheitspolitik der Rosa Luxemburg Stiftung in Berlin, Arbeiten zu Ostseegeschichte und Energieversorgung
Teil I
Kernpunkte
Einleitung
Geschichtspolitik vielgestaltig und widersprüchlich
Teil II
Estland 42-mal in 1000 Jahren von Russland angegriffen? – Fake statt Fakten
Systematische Unterwerfung der Esten - zuerst durch Dänen, Schweden und Deutsche
Russische Westerweiterung
Napoleons Feldzug nach Moskau und die polnisch-russische Erbfeindschaft
Polnische Osterweiterung unter Pilsudski
Teil III
Die postrevolutionäre Außenpolitik der UdSSR zur Überwindung der Isolation
Das Scheitern einer Anti-Hitler-Koalition mit den Westmächten 1939
Zur Logik von Geschichtspolitik
Schlussbemerkung
Kernpunkte
Geschichtspolitik tritt in vielfältigen Formen auf. Sie kann als nationaler Gründungsmythos eine vergleichsweise harmlose Variante annehmen. Problematisch wird es meist, wenn Geschichtspolitik das Bild anderer Völker und Länder zeichnet, vor allem dann, wenn es dabei Konflikte und Krieg gab oder gibt. In auf Dauer gestellten Konflikten wird Geschichte zur Waffe für psychologische und kognitive Kriegführung. Gerade im akuten Konflikt mit Russland und der existentiellen Bedeutung von Krieg und Frieden ist das ein großes Problem. Deshalb ist ein nüchterner, unparteiischer Blick auf Geschichte notwendig. Vor diesem Hintergrund werden einige historische Perioden in der Geschichte Estlands, Polens und Russlands skizziert, an denen wesentliche Elemente der Funktionsweise von Geschichtspolitik sichtbar werden. Der Beitrag versucht deutlich zu machen, dass Geschichtspolitik eine ideologische Konstruktion ist, die in Konfliktsituationen dazu benutzt wird, Spannungen anzuheizen und Kriegsbereitschaft in den eigenen Reihen zu fördern.
Einleitung
„Ein russischer Angriff ist jederzeit möglich. Da sind wir nicht blauäugig. In den letzten tausend Jahren wurden wir 42-mal von Russland angegriffen – im Schnitt alle 25 Jahre.“ So im Juni 2025 der estnische EU-Abgeordnete (MdEP) Riho Terras, Christdemokrat und ehem. Generalstabschef Estlands.[1]
Wir haben es hier mit einem klassischen Beispiel von nationalistischer Geschichtspolitik im Dienste von Feindbildproduktion zu tun. Geschichtspolitik ist, anders als seriöse, wissenschaftlicher Wahrheit verpflichtete Geschichtsschreibung, der Versuch, Geschichte gegenwärtigen Interessen dienstbar zu machen. Vergangenheit wird so politisiert und ideologisiert. Dafür gibt es viele Instrumente, von Denkmälern, Straßennamen, Gedenkstätten, Fahnen, Museen über Lehrpläne, Institute, Medien und andere Einrichtungen der ideologischen Apparate, über Literatur, Theaterstücke, Opern und bildender Kunst bis hin zu zur akademischen Geschichtsschreibung. Es entstehen nationale Mythen. Wenn eine bestimmte geschichtspolitische Orientierung hegemonial ist, fällt den meisten, die in ihr leben, dies gar nicht mehr als Hegemonie auf. Sie glauben das sei das Normale, Vernünftige quasi Natürliche. Kehrseite ist die Eliminierung entsprechender Symbole einer anderen Lesart der Geschichte.
Geschichtspolitik gab und gibt es zu allen Zeiten und überall auf der Welt. In Zeiten von internationalen Konflikten, Spannungen und Krieg, wie wir sie gegenwärtig erleben, hat sie Hochkonjunktur und bekommt enormes politisches Gewicht. So wimmelt es im Konflikt mit Russland geradezu von ähnlichen Behauptungen wie die unseres estnischen MdEP und Ex-Generalstabschef. Geradezu berüchtigt ist seine Landsmännin Kaja Kallas, ehemalige Ministerpräsidentin und derzeit EU-Außenbeauftragte, die regelmäßig durch russophoben Fanatismus auffällt.
Natürlich könnte man auch den deutschen Kanzler heranziehen, oder seinen Außenminister Wadephul, der meint „Russland wird immer ein Feind für uns bleiben“,[2] und viele andere. Allerdings erhebt die politische Klasse Estlands - ähnlich wie die anderen baltischen Staaten und Polens - den Anspruch, aufgrund historischer Erfahrung und geographischer Lage, die russische Politik besser einschätzen zu können als andere. Das kann sich zu einer dünkelhaften Selbstüberschätzung steigern, wenn es etwa in der estnischen Tageszeitung Neatkariga Rita Avize - von der FAZ kritiklos in der Rubrik ‚Stimmen der Anderen’ zitiert - heißt: „So schwer es auch sein mag, es zuzugeben, aber es ist der Moment der Wahrheit gekommen, in dem Europa die Überlegenheit seiner Zivilisation über die primitive Ordnung des Dschungels beweisen muss.“ [3] Ein klarer Fall von Euro-Chauvinismus.
Vor diesem Hintergrund liegt in diesem Text der Fokus auf Estland und Polen. Dabei kann allerdings der Hitler-Stalin-Pakt aufgrund seiner verhängnisvollen Bedeutung für die baltischen Staaten und Polen und der bis heute dazu anhaltenden Debatten nicht ausgeklammert bleiben. Deshalb wird auf den Pakt und seine Vorgeschichte etwas ausführlicher eingegangen.
Geschichtspolitik vielgestaltig und widersprüchlich
Geschichtspolitik tritt in vielfältigen Formen auf. Sie kann als nationaler Gründungsmythos eine identitätsbildende Funktion für den inneren Zusammenhalt eines Gemeinwesens haben, was eine vergleichsweise harmlose Variante ist - vorausgesetzt sie geht nicht mit einer Überlegenheitsideologie einher. Problematisch wird es meist, wenn Geschichtspolitik das Bild anderer Völker und Länder zeichnet, vor allem wenn es dabei Konflikt und Krieg gab oder gibt.
Das Bild muss dabei nicht immer negativ sein. So haben z.B. die Westdeutschen nach 1945 ein positives Bild von den USA entwickelt, das aber jetzt interessanterweise dabei ist, sich rapide ins Gegenteil zu verwandeln. Generell aber ist geschichtspolitische Wahrnehmung anderer Länder selektiv und voller Klischees. Im Fall von realen zwischenstaatlichen Konflikten entwickelt sie sich leicht zum Feindbild, in dem das Fremde dämonisiert und das Eigene idealisiert wird. Ein prominentes Beispiel ist die deutsch-französische Erbfeindschaft, die seit den napoleonischen Kriegen über den deutsch französischen Krieg 1870/71 und die beiden Weltkriege auf beiden Seiten als wesentlicher Teil der damaligen Herrschaftsideologie eine verhängnisvolle Rolle auf beiden Seiten spielte.
In solchen auf Dauer gestellten Konflikten wird Geschichte zur Waffe für psychologische und kognitive Kriegführung. Die Grenzen zwischen wissenschaftlich-seriöser Analyse der Geschichte und Geschichtspolitik verschwimmen dann leicht, weil die akademische Historiographie sich in den Dienst der Außenpolitik des jeweiligen Landes stellen lässt. Ein typisches Beispiel findet sich in der deutschen Osteuropaforschung, die als Politikberatung schon der imperialistischen Außenpolitik des wilhelminischen Deutschlands und dann den Nazis diente. Das setzte sich leicht modifiziert im Kalten Krieg in Westdeutschland fort und zeigt sich gegenwärtig wieder, wenn Historiker zu Kriegstreibern werden, wie z.B. Schulze-Wessel, ein führender Repräsentant der Disziplin, der im Ukrainekrieg zur Lieferung von Taurus-Raketen auffordert und glaubt „die Europäer“ könnten durch eine solche Eskalation „der Ukraine zum Sieg zu verhelfen, das heißt, zur Rückeroberung ihrer Territorien.“[4] Geschichtsforschung hat zwar eigentlich die Vergangenheit zum Gegenstand, hier aber wird sie zu militaristischer Politikberatung für die Gegenwart.
Die Verfestigung von Feindbildern wird durch institutionelle Verankerung nicht nur in der Politik, sondern auch in Medien, im Bildungswesen und bis in die Künste hinein abgesichert und sickert so ins Alltagsbewusstsein ein. Auf Dauer gestellt verselbständigt sie sich und wird zum Common sense. Typisch dafür die Äußerung von Außenminister Wadephul einige Wochen vor seiner Ernennung, Russland werde „immer ein Feind und eine Gefahr für unsere europäische Sicherheit sein“.[5]
Feindbilder werden so zum materiellen, geschichtsmächtigen Faktor. Die Rechtfertigung von Konfrontation und feindseliger Politik durch das Feindbild wird Teil eines sich selbst bestätigenden und verstärkenden Rückkopplungsprozesses und wirkt so als Treiber für die Fortsetzung oder Verschärfung von Konfrontation. Das Feindbild kann dann in krisenhaften Zuspitzungen von Regierungen und Medien abgerufen werden, um in der Bevölkerung Loyalität zur Regierung oder gar Kriegstüchtigkeit zu erzeugen.
[1] Terras, Riho: „Wenn die Russen kommen, schiesst in Estland jeder Baum“, Interview mit Lara Lattek, aktualisiert am 17.06.2025, in: https://www.gmx.ch/magazine/politik/russland-krieg-ukraine/riho-terras-russen-schiesst-estland-baum-41083006; abgerufen: 23.06.2025
[2] Berliner Zeitung, 29.4.2025
[3] FAZ, 2.6.2022, S. 2
[4] So der Osteuropa-Historiker an der Uni München, Martin Schulze-Wessel, in der FAZ, 5.2.2024, S. 6. Von 2012 bis 2016 war Schulze-Wessel Vorsitzender des deutschen Historikerverbands.
[5] Die Welt, 5.2.2025. https://www.welt.de/politik/ausland/article255346476/Gespraech-ueber-Taurus-CDU-Politiker-geht-Fake-Anrufern-auf-den-Leim.html
Rüstungsexporte der USA nach Deutschland
Crowdfunding-Ergebnis: Können wir weitermachen?
In diesem Video legt unser Gründer Zain Raza das Endergebnis unserer Crowdfunding-Kampagne offen und erläutert, welche konkreten Folgen dieses Ergebnis für die Zukunft von acTVism hat. Das Video zeigt, wo unsere Organisation nach der Kampagne steht, welche Möglichkeiten sich daraus ergeben und welche Grenzen damit verbunden sind. Es geht um Entscheidungen, Zeiträume und darum, wie […]
Der Beitrag Crowdfunding-Ergebnis: Können wir weitermachen? erschien zuerst auf acTVism.
Die „regelbasierte Ordnung“ Anfang 2026
Bremerhaven: Marinehafen
Venezuelas Ex-Außenminister: „Es gab keinen Regimewechsel“ – Nach der US-Entführung
Wir befinden uns derzeit in unserer jährlichen Crowdfunding-Kampagne. Wenn Sie möchten, dass unser unabhängiges und gemeinnütziges Mediennetzwerk auch im Jahr 2025 fortbesteht, beteiligen Sie sich bitte an dieser Kampagne, indem Sie hier klicken. Am 3. Januar kam es zu einem massiven Einsatz des US-Militärs in Caracas, bei dem Venezuelas Präsident Nicolás Maduro und First Lady Cilia […]
Der Beitrag Venezuelas Ex-Außenminister: „Es gab keinen Regimewechsel“ – Nach der US-Entführung erschien zuerst auf acTVism.
Bewegung im Wandel der „Zeitenwende“
Trump & Netanjahu signalisieren Eskalation ihres Genozids
Wir befinden uns derzeit in unserer jährlichen Crowdfunding-Kampagne. Wenn Sie möchten, dass unser unabhängiges und gemeinnütziges Mediennetzwerk auch im Jahr 2025 fortbesteht, beteiligen Sie sich bitte an dieser Kampagne, indem Sie hier klicken. Ende 2025 trafen sich Benjamin Netanjahu und Donald Trump erneut in den Vereinigten Staaten. Auf der anschließenden Pressekonferenz machten beide Aussagen, die weit […]
Der Beitrag Trump & Netanjahu signalisieren Eskalation ihres Genozids erschien zuerst auf acTVism.
Wie planen die USA Venezuela zu kontrollieren? | Glenn Greenwald
Wir befinden uns derzeit in unserer jährlichen Crowdfunding-Kampagne. Wenn Sie möchten, dass unser unabhängiges und gemeinnütziges Mediennetzwerk auch im Jahr 2025 fortbesteht, beteiligen Sie sich bitte an dieser Kampagne, indem Sie hier klicken. In diesem Video, das exklusiv auf Deutsch auf unserem Kanal veröffentlicht wurde, analysiert der Pulitzer-Preisträger Glenn Greenwald die US-Bombardierung Venezuelas und die anschließende […]
Der Beitrag Wie planen die USA Venezuela zu kontrollieren? | Glenn Greenwald erschien zuerst auf acTVism.
Venezuela: Das Interview, das in den Medien fehlt | Gregory Wilpert
Wir befinden uns derzeit in unserer jährlichen Crowdfunding-Kampagne. Wenn Sie möchten, dass unser unabhängiges und gemeinnütziges Mediennetzwerk auch im Jahr 2025 fortbesteht, beteiligen Sie sich bitte an dieser Kampagne, indem Sie hier klicken. In dieser Folge von Die Quelle spricht unser Gründer und Redakteur Zain Raza mit Gregory Wilpert, Soziologe und Mitbegründer von Venezuelanalysis, über die […]
Der Beitrag Venezuela: Das Interview, das in den Medien fehlt | Gregory Wilpert erschien zuerst auf acTVism.
Zukünftige Klimakatastrophe – gibt es noch hoffnungsvolle Perspektiven?
Seit mehreren Jahrzehnten ist der menschengemachte Klimawandel eines der zentralen globalen Probleme. Dennoch nimmt paradoxerweise der Skeptizismus gegenüber dieser wissenschaftlich gut belegten Tatsache in Teilen der Gesellschaft wieder zu. Dieser Text rekonstruiert die zentralen Argumente des Vortrags von Dr. Helmut Selinger, den er am 19. November 2025 in München gehalten hat. Der Text verbindet naturwissenschaftliche Erkenntnisse, politische Erfahrungen und gesellschaftstheoretische Überlegungen zu einer umfassenden Analyse der Klimakrise – sowie möglicher Auswege.
Zunehmender Skeptizismus gegenüber dem menschengemachten Klimawandel
Klimawandel-Skeptizismus tritt in unterschiedlichen Formen auf. Er reicht von offener Leugnung bis hin zu subtileren Formen der Relativierung. Prominente Beispiele finden sich im rechtspopulistischen und neoliberalen Spektrum, etwa bei Donald Trump oder der AfD. Trump bezeichnete den Klimawandel bereits 2012 als chinesische Erfindung zur Schwächung der US-Wirtschaft und sprach 2025 erneut vom „größten Schwindel aller Zeiten“.
Solche Positionen entstehen nicht zufällig. Sie sind eng mit den Interessen fossilistischer Konzerne verbunden, die gezielt eine breite klimaskeptische Szene finanzieren. Pseudowissenschaftliche Institute wie das EIKE werden dabei als scheinbar seriöse Quellen genutzt, um Zweifel an der Klimaforschung zu säen.
Die Leugnung des menschengemachten Klimawandels ist aus gesellschaftlicher Perspektive hochproblematisch. Sie untergräbt wissenschaftliche Erkenntnisse und blockiert notwendige politische Maßnahmen. Während eine kritische Diskussion über konkrete Klimaschutzmaßnahmen legitim und notwendig ist, stellt die grundsätzliche Infragestellung der Klimawissenschaft eine Form von Verantwortungslosigkeit dar.
Die globale Klimasituation – naturwissenschaftlich und klimapolitisch
Bereits seit den 1980er Jahren wird intensiv erforscht, welchen Anteil menschliche Aktivitäten an der globalen Erwärmung haben. Mit dem ersten Bericht des Weltklimarats (IPCC) im Jahr 1990 wurde diese Frage eindeutig beantwortet: Die Hauptursache der globalen Erwärmung sind die vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen.
Seitdem haben zehntausende wissenschaftliche Studien diese Erkenntnis weiter untermauert. In sechs IPCC-Sachstandsberichten wurden die Ergebnisse regelmäßig zusammengefasst – mit einem klaren Trend: Die frühen Warnungen haben sich bestätigt, teils sogar als zu optimistisch erwiesen. Der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur seit dem vorindustriellen Zeitalter ist unübersehbar.
Die Folgen des Klimawandels sind bereits heute weltweit sichtbar: zunehmende Dürreperioden, ausgedehnte Waldbrände, häufigere und intensivere Hitzewellen, Starkregenereignisse mit Überschwemmungen, zerstörerische tropische Stürme sowie massive Verluste an Biodiversität. Hinzu kommen die Versauerung der Ozeane, das beschleunigte Abschmelzen der Polkappen und der Anstieg des Meeresspiegels. Besonders besorgniserregend ist die Gefahr, sogenannte Kipppunkte im Klimasystem zu überschreiten, nach denen sich Prozesse nicht mehr umkehren lassen.
Klimapolitik, Kapitalismus und die Frage globaler Gerechtigkeit
Obwohl das Problem des menschengemachten Klimawandels seit über 35 Jahren politisch anerkannt ist, fällt die Bilanz der internationalen Klimapolitik ernüchternd aus. Seit Mitte der 1990er Jahre fanden nahezu jährlich große UN-Klimakonferenzen statt – von Kyoto über Paris bis zuletzt Belém im Jahr 2025. Trotz dieser Vielzahl an Gipfeln, Abkommen und politischen Selbstverpflichtungen sind die globalen Treibhausgasemissionen kontinuierlich weiter angestiegen. Dies macht deutlich, dass die bisherigen klimapolitischen Ansätze weder in ihrer Zielsetzung noch in ihrer Umsetzung ausreichend waren, um der Dynamik der Klimakrise wirksam zu begegnen.
Die Ursachen dieses Scheiterns liegen nicht allein im fehlendem politischen Willen einzelner Staaten, sondern in den strukturellen Rahmenbedingungen, innerhalb derer Klimapolitik heute stattfindet. Eine wirksame Klimastrategie würde voraussetzen, dass in allen Ländern ambitionierte Maßnahmen zur drastischen Reduktion von Treibhausgasemissionen ergriffen werden. Darüber hinaus müsste die internationale Klimapolitik konsequent am Prinzip der globalen Klimagerechtigkeit ausgerichtet sein. Denn ein zentraler Widerspruch der Klimakrise besteht darin, dass jene Länder des globalen Südens, die historisch am wenigsten zur Erderwärmung beigetragen haben, heute oft am stärksten von ihren Folgen betroffen sind. Ein gerechter Ausgleich zwischen globalem Norden und Süden – etwa durch finanzielle Transfers, Technologietransfer und die Anerkennung von Klimaschulden – wäre daher unabdingbar.
An diesem Punkt stößt die bisherige Klimapolitik jedoch an eine grundlegende Grenze: Sie bewegt sich fast ausschließlich innerhalb der Logik des kapitalistischen Wirtschaftssystems. Jenseits parteipolitischer Differenzen stellt sich deshalb die grundsätzliche Frage, ob der Kapitalismus mit ökologischer Nachhaltigkeit überhaupt vereinbar ist. Der Kapitalismus ist strukturell auf permanentes Wirtschaftswachstum, Profitmaximierung und Konkurrenz angewiesen. In Situationen, in denen ökologische Erfordernisse mit ökonomischen Interessen kollidieren, setzt sich in der Regel der Profit durch – nicht der Umwelt- oder Klimaschutz.
Versuche, diese strukturelle Spannung durch eine „grüne“ Modernisierung des Kapitalismus aufzulösen, etwa in Form eines Green New Deal oder klima-keynesianischer Investitionsprogramme, beruhen auf der Annahme, dass sich Wirtschaftswachstum dauerhaft von Umweltbelastung und CO₂-Emissionen entkoppeln lasse. Empirisch lässt sich eine solche Entkopplung jedoch bislang nicht belegen, insbesondere wenn langfristige Effekte und Rebound-Effekte berücksichtigt werden. Effizienzgewinne werden häufig durch steigenden Konsum wieder aufgehoben, sodass der ökologische Gesamteffekt begrenzt bleibt.
Eine wirksame und nachhaltige Lösung der Klimakrise würde daher eine grundlegende Transformation des Wirtschaftsmodells erfordern. Für die Länder des globalen Nordens bedeutet dies eine bewusste Reduktion von Produktion und Konsum auf ein ökologisch tragfähiges Niveau, während es im globalen Süden zunächst darum geht, die materiellen Voraussetzungen für ein gutes, menschenwürdiges Leben zu sichern. Diese unterschiedliche Ausgangslage macht deutlich, dass Klimaschutz ohne globale Gerechtigkeit nicht möglich ist. Gleichzeitig zeigt die bisherige Erfahrung, dass ein solcher Ausgleich innerhalb des kapitalistischen Systems kaum realisierbar erscheint, da dieses auf Wachstum, Externalisierung und Ungleichheit angewiesen ist.
Die Klimakrise erweist sich damit nicht nur als ökologische, sondern als zutiefst systemische Krise. Sie stellt die bestehende Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung grundsätzlich in Frage und macht deutlich, dass effektiver Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Organisation untrennbar miteinander verbunden sind.
Ökologische Marx-Neuinterpretation, Degrowth und gesellschaftliche Perspektiven
Angesichts der ökologischen Zuspitzung der Klimakrise gewinnt eine grundlegende theoretische Neubewertung kapitalismuskritischer Ansätze an Bedeutung. In diesem Zusammenhang rückt insbesondere eine ökologische Relektüre des Marxismus in den Fokus. Der japanische Philosoph Kohei Saito hat gezeigt, dass Karl Marx in seinen späten Lebensjahren ökologische Fragen intensiv studierte und seine Kritik des Kapitalismus weiterentwickelte. Marx erkannte zunehmend, dass die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen neben der Ausbeutung der Arbeitskraft einen zentralen inneren Widerspruch der kapitalistischen Produktionsweise darstellt.
Aus dieser Perspektive interpretiert Saito den späten Marx als Vordenker eines sogenannten Degrowth-Kommunismus. Gemeint ist eine Gesellschaftsform, die sich bewusst vom Wachstumszwang löst und stattdessen auf kollektives Eigentum, ökologische Nachhaltigkeit und demokratische Selbstverwaltung ausgerichtet ist. Diese Vision unterscheidet sich grundlegend von staatssozialistischen Modellen des 20. Jahrhunderts. Sie zielt nicht auf zentralistische Planung, sondern auf eine dezentrale, egalitäre und ökologisch eingebettete Organisation von Wirtschaft und Gesellschaft, in der Produktion und Reproduktion an realen gesellschaftlichen Bedürfnissen orientiert sind.
Der Begriff Degrowth wird dabei ausdrücklich nicht als Verzichtsideologie verstanden, die Armut oder Einschränkung romantisiert. Vielmehr geht es um eine radikale Reduktion ökologisch zerstörerischer, gesellschaftlich überflüssiger Produktion – insbesondere von Luxusgütern, Statussymbolen und ressourcenintensivem Konsum – bei gleichzeitiger Wiedergewinnung eines allgemeinen öffentlichen Reichtums. Historische Gemeingüter, sogenannte Commons, waren keineswegs von Mangel geprägt. Erst durch die kapitalistische Durchsetzung von Privateigentum und Marktlogik wurde gesellschaftlicher Reichtum systematisch in Knappheit und Ungleichheit überführt.
Zentrale Elemente einer solchen postkapitalistischen Perspektive sind die Demokratisierung von Energie, Infrastruktur und Produktion. Bürgerenergie, Genossenschaften, Commons-basierte Produktionsformen und offene Technologien spielen dabei eine Schlüsselrolle. Insbesondere erneuerbare Energien eignen sich aufgrund ihrer dezentralen Struktur für demokratische Kontrolle und kollektive Verwaltung. Langfristig geht es um eine Wirtschaftsweise, in der Gebrauchswerte, soziale Beziehungen, kulturelle Tätigkeiten und freie Zeit wichtiger werden als monetäres Wachstum und Profitmaximierung.
Eine der größten Herausforderungen auf dem Weg zu einer solchen Gesellschaft liegt weniger in technischen oder materiellen Fragen als in der gesellschaftlichen Vorstellungskraft. Es scheint oft leichter, sich das Ende der Welt vorzustellen als das Ende des Kapitalismus. Dennoch existieren weltweit bereits soziale Bewegungen, Gemeinschaften und Netzwerke, die alternative Formen des Wirtschaftens und Zusammenlebens praktisch erproben. Diese Initiativen zeigen, dass andere gesellschaftliche Modelle nicht nur denkbar, sondern bereits ansatzweise real sind – und dass Hoffnung weniger aus abstrakten Entwürfen als aus konkreter kollektiver Praxis entsteht.
Quelle:
Vortragsfolien „Zukünftige Klimakatastrophe – gibt es noch hoffnungsvolle Perspektiven?“ von Dr. Helmut Selinger, 19.11.2025
Download:
Yanis Varoufakis: 2025 war der Wendepunkt – Europas Zerfall beginnt
Wir befinden uns derzeit in unserer jährlichen Crowdfunding-Kampagne. Wenn Sie möchten, dass unser unabhängiges und gemeinnütziges Mediennetzwerk auch im Jahr 2025 fortbesteht, beteiligen Sie sich bitte an dieser Kampagne, indem Sie hier klicken. In diesem Video übermittelt der Ökonom und ehemalige griechische Finanzminister Yanis Varoufakis eine Neujahrsbotschaft von DiEM25, in der er darlegt, dass das Wirtschaftsmodell […]
Der Beitrag Yanis Varoufakis: 2025 war der Wendepunkt – Europas Zerfall beginnt erschien zuerst auf acTVism.
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »