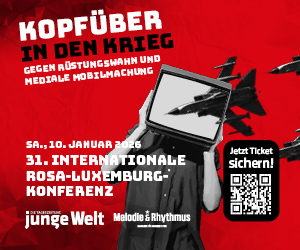Meldungen
Ich wollte nach Palästina reisen – dann passierte DAS
In diesem Video berichtet der investigative Journalist und Menschenrechtsanwalt Dimitri Lascaris von seinem Versuch, im Oktober 2025 von Jordanien nach Palästina zu reisen. Was er dabei an der israelischen Grenze erlebte, hat ihn tief erschüttert. Er erzählt von den Sicherheitskontrollen an der Allenby Bridge, der Behandlung der Palästinenser – und warum diese Erfahrung seinen Blick […]
Der Beitrag Ich wollte nach Palästina reisen – dann passierte DAS erschien zuerst auf acTVism.
Die reichsten Deutschen – wie sich Macht und Vermögen verteilen
Zur gleichen Zeit, in der die CDU/CSU-SPD-Koalition neue Scheußlichkeiten ausbrütet, um Bürgergeldbezieher noch mehr zu kujonieren, ihnen damit drohen, bei Terminversäumnissen das Bürgergeld um 30% bis zu 100 % zu kürzen, ja selbst die Wohnungskosten nicht mehr zu übernehmen (aber damit wird, laut Merz, "niemand in die Obdachlosigkeit getrieben"), veröffentlicht das Manager Magazin sein alljährliches Sonderheft über den Reichtum in Deutschland: "Die 500 Reichsten Deutschen. Wie sich Macht und Vermögen verteilen."
Scheinbar kritisch (aber durchaus richtig!) schreibt die Redaktion über ihre Reichenliste: "Noch nie war sie so notwendig wie heute. Denn Vermögen bedeutet Macht." Und über die Verteilung von Vermögen und Macht soll mit der Veröffentlichung Transparenz hergestellt werden. Ja, selbst Thomas Piketty ("Das Kapital im 21. Jahrhundert") wird zitiert, der die Debatte um die wachsende Ungleichheit in westlichen Gesellschaften enorm beschleunigt habe.
Festgestellt wird: "Obwohl die deutsche Wirtschaft seit drei Jahren stagniert, gibt es hierzulande… immer mehr Milliardäre" – ihre Zahl stieg von 226 auf 256. Sieht man sich nur die hundert Reichsten an, so hat sich ihr Vermögen seit 2001 (dem ersten Jahr der Reichenliste) von 263 Mrd. Euro auf 758 Mrd. Euro in 2025 fast verdreifacht; das Bruttoinlandsprodukt hat sich im selben Zeitraum "nur" verdoppelt. Damit stieg der Anteil der Top 100 am BIP von 12% auf 17,7%. Und auch seit dem letzten Jahr, mit einer Wirtschaft in der Rezession, ging es "für die meisten der Top 500 auch im vergangenen Jahr vermögensmäßig bergauf" – erfreulich, nicht wahr?
Aber auch eine beunruhigende Frage wird aufgeworfen: "Werden Milliardäre bald höher besteuert?" – "Nicht auszuschließen", lautet die Antwort. Aber gemach: Zwar plädiere die Regierungspartei SPD in ihrem Wahlprogramm dafür, jedoch: "Mit dem Koalitionspartner CDU/CSU dürfte das allerdings kaum umsetzbar sein." Wohl wahr: Wenn es dafür nicht eine breite gesellschaftliche Bewegung unter Einschluss der Gewerkschaften gibt, müssen sich die Superreichen auch in den kommenden Jahren keine Sorgen machen.
Einige Einzelheiten: Der reichste Deutsche ist, wie schon im letzten Jahr, Dieter Schwarz, der sein Geld mit Einzelhandel (Lidl, Kaufland), Entsorgung, IT und Immobilien "verdient", mit 46,5 Mrd. Euro; verdienstvoll vom Manager Magazin ist es, dass bei allen Reichen die Quellen ihrer Vermögen aufgeführt werden. So werden bei den mit 36,5 Mrd. Zweitplatzierten, den Familien Susanne Klatten und Stefan Quandt, nicht nur BMW, sondern auch ihre Beteiligungen an sehr unterschiedlichen Firmen aufgeführt. Die Familie Porsche findet sich nach einem herben Rückgang von knapp 4 Mrd. Euro im Vergleich zum Vorjahr mit 15,5 Mrd. Euro auf Platz 12, die Schäfflers wiederum (Autozulieferer, Maschinenbau), die einen großangelegten Arbeitsplatzabbau durchführen, rückten mit einem Zuwachs von 2,5 Mrd. auf 10,1 Mrd. Euro um einige Plätze nach oben, auf Platz 21. Auch Medienunternehmer wie Mohn (Bertelsmann, Platz 29 mit 7,2 Mrd. Euro Euro), Familie Holtzbrinck (3,3 Mrd., Platz 79), Friede Springer und Mathias Döpfner (Springer Verlag, 2,9 Mrd. Euro und Platz 94) finden sich unter den Milliardären.
"In Deutschland stieg 2024 das Gesamtvermögen der Superreichen um 26,8 Milliarden US-Dollar auf inzwischen 625,4 Milliarden US-Dollar. Neun Milliardäre kamen hinzu, insgesamt seien es jetzt 130. Deutschland (83,5 Mio. Einwohner) hat damit nach den USA (345 Mio. Einwohner), China (1.437 Mrd. Einwohner) und Indien (1.417 Mrd. Einwohner) die meisten Milliardäre." (Oxfam "Bericht "Takers not Makers", 20.1.2025)
Das Magazin stellt fest: "Lange Jahre schien es, als sei Deutschland ein Land des alten Geldes – im Gegensatz etwa zu den USA." Doch seit 2001 tauchen auch Tech-Milliardäre auf wie etwa Dietmar Hopp (Platz 11 mit 15,8 Mrd. Euro) und Hasso Plattner (Platz 9 mit 17,7 Mrd Euro), beide SAP-Gründer.
Familie Kraut, die mit Elektrogeräten ("Bizerba") ein Vermögen von "nur" 450 Millionen scheffelte und damit am Ende der Reichstenliste zu finden ist, hat ihr Mitglied Nicole Hoffmeister-Kraut als Wirtschaftsministerin in die baden-württembergische Landesregierung geschickt. Diese direkte Wahrnehmung von "politischer Verantwortung" ist, im Gegensatz zu den USA, noch (?) ungewöhnlich für die Kaste der Allerreichsten.
"Als schnellster Weg, reich zu werden, gilt gemeinhin das Erben.", schreibt das Manager Magazin. Und bringt als Beispiel für "dumm gelaufen" die Erben von Heinz Hermann Thiele (Knorr Bremse), die bei seinem Tod ein Vermögen von 15 Mrd. Euro erbten; allerdings hatte er juristisch ungenügend vorgesorgt, sodass sie an den Freistaat Bayern (die Erbschaftssteuer ist eine Ländersteuer) 4 Mrd. Euro zahlen mussten. Mit 9 Mrd. Euro und Platz 23 geht es den beiden Töchtern aber wahrscheinlich doch recht gut.
Steuerpolitik im Interesse der SuperreichenSuperreiche und ihre Konzerne profitierten weltweit von Steuersenkungen und großzügigen Ausnahmeregelungen, während die Steuern für Milliarden von Menschen stiegen. In Deutschland spielen Lobbyverbände wie „Die Familienunternehmer e.V.“ und die „Stiftung Familienunternehmen und Politik“ bei der Durchsetzung einer solchen Steuerpolitik eine wesentliche Rolle. Das Ergebnis: Milliardärinnen und Multimillionärinnen zahlen vielerorts weniger Steuern auf ihr Einkommen als der Rest der Bevölkerung.
Gewinne für Superreiche durch steigende KonzernmachtWeitere Vorteile für Superreiche ergeben sich aus der zunehmenden Monopolisierung der Wirtschaft. Einzelne Branchen werden von immer weniger Unternehmen dominiert. Die 20 reichsten Menschen der Welt sind EigentümerInnen oder GroßaktionärInnen von Großkonzernen, von denen viele durch eine marktbeherrschende Stellung so mächtig wurden. Aus Oxfams Bericht zu sozialer Ungleichheit. Milliardärsmacht beschränken, Demokratie schützen.
Die Reichstenliste "bietet Nutzwert für Menschen, die sich professionell mit Hochvermögenden befassen.", schreibt die Redaktion. Aber auch für Menschen, die sich mit einem Gesellschaftssystem nicht abfinden wollen, in dem die Reichsten immer reicher und mächtiger werden, haben diese Sonderhefte mit ihren akribisch zusammengestellten Zahlen und Fakten großen Nutzwert für gewerkschaftliche und politische Arbeit.
„Vertrauenskrise“ des Kapitalismus in Deutschland – doch wem nützt es?
Der „Herbst der Reformen“ zeigt wenig Wirkungskraft: Die eingesteuerten politischen Maßnahmen der Deregulierung, steuerliche Entlastungen für Industrie-Konzerne sowie die Einsparungen für soziale Errungenschaften vermögen es nicht, das verloren gegangene Vertrauen deutscher Unternehmen in die Zukunft aufzuhalten.
Die vom Institut für Demoskopie Allensbach im Auftrag von FTI-Andersch durchgeführte Befragung von 169 Industrieunternehmen, Mitte Oktober 2025, liefert Erkenntnisse des verbreiteten Zukunfts-Pessimismus in Deutschlands zentralen Industrie-Branchen. Ein erheblicher Teil der Firmen (51 %) bezweifelt die eigene künftige Wettbewerbsfähigkeit und prognostiziert Stagnation oder Abschwung im Geschäftsverlauf der nächsten zwölf Monate. Besonders betroffen geben sich die Auto-Zulieferer: 60 Prozent von ihnen sehen keine Chancen mehr, eine Geschäftstätigkeit im boomenden Automarkt China aufzunehmen, und über die Hälfte der Maschinenbauer befürchtet, die derzeit in Teilbereichen noch angenommene Technologieführerschaft bald an internationale Wettbewerber zu verlieren. Unternehmen energieintensiver Sektoren, etwa aus Chemie und Stahl, geben zu 94 Prozent an, eine Verlagerung ihrer Produktionsanlagen ins Ausland ernsthaft in Erwägung zu ziehen.
Globale Unsicherheiten, wirtschafts- und geopolitische Krisen sowie Störungen in den Lieferketten verstärken die Herausforderungen aus Sicht der Betriebe. 83 % der Studien-Teilnehmer berichten von einer deutlich erschwerten Planbarkeit, infolgedessen 63 % ihre Investitionen verschieben.
Die jüngsten Reformmaßnahmen der Bundesregierung werden von den Unternehmen bislang wenig als Erfolgstreiber empfunden und das Zutrauen in eine starke Reform-Politik bleibt aus. (1) Laut der Studie beurteilen 83 Prozent der Unternehmen die Planung der Geschäftsentwicklung der kommenden Monate inzwischen als sehr schwierig und demzufolge verschiebt jeder zweite der Befragten (63 Prozent) anstehende Investitionen.
Der gewählte Studientitel „Deutsche Unternehmen verlieren ihr Vertrauen an die Zukunft“ offenbart anscheinend eine massive „Vertrauenskrise“ im deutschen Industriesektor und führt zu der Annahme, dass die Industriebranche nicht mehr auf die Wirtschaftskraft eines exportlastigen, aber innovations-retardierenden Volkswirtschaft vertraut und den Versprechen der politischen Entscheidungsträger immer weniger Glauben schenkt. Gemeint sind hier die großmannsüchtigen Ankündigungen der aktuellen CDU/CSU/SPD-Regierung, dass im Sinne deutscher konkurrenzfähiger Wirtschaftspolitik jetzt alles besser und der Abstiegssog bald „reformerisch“ gestoppt werde. (2); (3)
Nach Auffassung der mit der Befragung beauftragten Beratungs-Firma FTI-Andersch zeigt die Studie, dass viele Unternehmen selbst zu verantwortende strukturelle Probleme in ihren Geschäftsmodellen hätten und Deutschland nicht nur aufgrund schlechter externer Rahmenbedingungen im internationalen Wettbewerb zurückgefallen sei.
Neben den Beispielen Maschinenbau und Chemie-u. Stahl-Industrie führt die Studie aus, dass es 8 von 10 Firmen der Autozuliefer-Branche nicht gelungen sei, an dem mächtig wachsenden Elektro-Automobilmarkt China teilzuhaben und den Rückgang der Belieferung deutscher Automobilunternehmen dadurch mindestens zu kompensieren.
Einen Ausweg sehen 79 Prozent der Auto-Zulieferer durch die Ausweitung ihrer Tätigkeit in anderen Branchen wie etwa der Energiebranche, der Medizintechnik, der Luftfahrt oder der Bahntechnik und vor allem durch die Ausweitung und Teilhabe an dem in Deutschland sich aufblähenden Rüstungsbereich. Die Aussichten auf eine Teilhabe an den schuldenfinanzierten Rüstungs-Milliarden drängt die Auto- und Zulieferbranche zur Geschäftserweiterung. Eine solche Teilhabe am Bau von Panzern und Drohnen wäre für die Zulieferbranche und Auto-Konzerne eine profitable Erweiterung ihres angestammten Geschäftsfeldes ziviler Fahrzeug-Produktion. (4)
Während führende Wirtschaftsinstitute noch argumentieren, die Rückgänge bei Auftragseingängen, Absatz, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit seien normale zyklische Schwankungen, erkennen inzwischen selbst Vertreter dieser Schulen, dass es sich um strukturelle Krisenerscheinungen handelt. Diese lassen sich nicht mehr durch kurzfristige Reformprogramme, Zugeständnisse an die privatwirtschaftlichen Unternehmen sowie Ausgaben-Kürzungen sozialer Leistungen in das „Lot“ der kapitalistischen Wirtschaftslogik zurückführen, sondern erfordere einen grundlegenden wirtschaftspolitischen und gesellschaftlichen Umbau. (5)
Es handelt sich also um strukturell geprägte Widersprüche, die sich aus den sich verschlechternden Verwertungsbedingungen der spätkapitalistischen Produktionsweise ergeben. So räumt auch die Bundesbank ein, dass die deutsche Wirtschaft in einer längeren Phase verhaltener Wachstumsperspektiven, erforderlicher struktureller Anpassungen und sozialen Verwerfungen stehe. Derartige makrowirtschaftliche Prognosen der Bundesbank, des ifo-Instituts und des Instituts der deutschen Wirtschaft führen aus, dass die Ursachen weit über zyklische Abschwächungen hinausreichen und auf eine mehrdimensionale Strukturkrise hindeuten. Sie legen den Schluss nahe, dass die deutsche Wirtschaft vor einem Übergang zu einem postindustriellen, durch Wohlstandsverluste und Fragmentierung geprägten Entwicklungszyklus stehe. (6) Die Analysen räumen ein, dass ein tiefgreifender Wandel der gesellschaftlichen Reproduktionsbedingungen anstehe, der auf die strukturellen Widersprüche innerhalb der spätkapitalistischen Produktionsweise verweist.
Diese Widersprüche entspringen aus gesellschaftskritischer Sicht aber nicht einzelnen Fehlentwicklungen oder kurzfristigen Marktstörungen, sondern sind den sich verschlechternden Verwertungsbedingungen des Kapitals selbst zuzuschreiben.
Schwindendes Vertrauen der Unternehmen – in was?So betrachtet ist die Aussage der zuvor zitierten Allensbach-/FTI-Studie, dass deutsche Unternehmen eine Phase großen Vertrauensverlusts in ihr eigenes kapitalistische Wirtschaften „durchmachen“, eher als moralischer oder psychologischer Zustandsbericht zu bewerten, der die ideologische Struktur des bürgerlichen Bewusstseins widerspiegelt.
Die eigentliche Grundlage der wirtschaftlichen Stagnation eines Produktionsprozesses wird demgegenüber in der Studie nur als Randnotiz erwähnt, bei dem die Organisation, Steuerung und Zielsetzung der Produktion primär auf die Erzielung von Profit ausgerichtet ist und die wirtschaftliche Verwertbarkeit und maximale Kapitalrendite als Wirtschaftsziel bestimmt.
Besonders für Deutschland ist es in der jetzigen Wirtschaftssituation zutreffend, dass die über Jahre auf Waren-Export basierende Profit-logik zunehmend an ihre inneren und äußeren Grenzen stößt: Globale Märkte sind weitgehend erschlossen, natürliche Ressourcen übernutzt und technologische Rationalisierung führt zu einer Entwertung menschlicher Arbeit in einem Ausmaß, das den Übergang zu neuen Zyklen der Kapitalakkumulation erschwert. Immer größere Mengen an Kapital finden keine hinreichend profitable Anlagemöglichkeit in der Produktion realer Güter, so dass spekulative, renditeträchtige Finanzmärkte die reale Wertschöpfung ersetzen.
Hinzu kommt eine wachsende Diskrepanz zwischen Produktionsvermögen und gesellschaftlichem Bedarf. Während technische Produktivität und globale Lieferketten ein potenziertes materielles Produktionsniveau ermöglichen, bleiben weite Teile der Bevölkerung von dieser Produktivität ausgeschlossen und sie werden von allgemeinen Wohlstandsgewinnen ausgeschlossen. Eine staatliche Nachfragestimulierung durch eine an der Mehrheit ausgerichteten Wirtschaftspolitik würde in erster Linie der Masse der privaten Haushalte als die wichtigsten Nachfrager zugutekommen. (7)
Der Wohlstand für die Bevölkerung stagniertNachdem dies aber weitestgehend ausbleibt, entstehen neue Formen sozialer Prekarität, verschärfte Konkurrenz und Abbau von Arbeitsplätzen sowie eine Übernutzung von natürlichen Ressourcen. (8) Und das BIP, das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf als wichtiger Wohlstandsindikator, stagniert insbesondere in Deutschland. Diese Stagnation bedeutet nicht nur ausbleibendes Wirtschaftswachstum, sondern auch stagnierende Realeinkommen für große Teile der Bevölkerung. Ein kontinuierlicher Anstieg des BIP pro Kopf, der früher Wohlstandsversprechen erfüllte, verweist heute signifikant auf die erreichten Grenzen des wachstumsorientierten Modells.
Im folgenden Schaubild zeigt sich die Wohlstandentwicklung für Deutschland im internationalen Vergleich in den vergangenen 10 Jahren.
Die Ursachen liegen wie oben angeschnitten in der Überakkumulation von Kapital, sinkenden Profitraten und der Verlagerung von Wertschöpfung in spekulative Bereiche, d. h. in Aktivitäten, die nicht unmittelbar zur Produktion von realen Gütern oder Dienstleistungen beitragen, sondern primär auf Finanzgewinne durch Spekulation abzielen (Han del mit Aktien, Anleihen etc. ausgerichtet sind. Der technologische Fortschritt führt gleichzeitig zu Rationalisierung und Arbeitsplatzabbau, ohne dass neue, gleichwertige Beschäftigungsmöglichkeiten entstehen. Der materielle Wohlstand der Lohnbeschäftigten stagniert. Der "Wohlstand" konzentriert sich zunehmend bei Kapitaleigentümern, während die Mehrheit der Bevölkerung von den Produktivitätszuwächsen abgekoppelt wird. Die BIP-Stagnation signalisiert somit eine systemische Krise des Kapitalismus.
Die vorherrschende Unternehmer-Mentalität in DeutschlandDie durch die Allensbach-Studie ermittelte „Vertrauenskrise“ ist dieser Argumentation folgend also nicht in „Mentalitätsproblemen“ der Unternehmer zu suchen, sondern in der inneren Widersprüchlichkeit der kapitalistischen Produktionsweise. Die Denkweise der Unternehmer ist kein persönlicher Charakterzug, sondern spiegelt ein Bewusstsein wider, das aus den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen der Produktion hervorgeht. Sie entsteht nicht im Einzelnen, sondern in jener Ordnung, die Gewinnstreben zur obersten Maxime macht.
Mit anderen Worten: Wenn Unternehmer über schrumpfende Profite und schlechte Verwertungsbedingungen jammern, so wie die Studie es zum Ausdruck bringt, ist dies weniger als ein psychologisches Versagen zu verstehen, sondern vielmehr als eine durch Fakten belegbare Reaktion auf abnehmende Gewinnmöglichkeiten. Das „Jammern“ über schrumpfende Profite spiegelt eher die reale ökonomische Situation wider als eine anfällige psychologische Haltung der Unternehmer.
Es ist die langfristige Tendenz im kapitalistischen Wirtschaftssystem, bei der die Profitrate, also das Verhältnis von Profit zum eingesetzten Kapital, trotz technischem Fortschritt und Produktivitätssteigerungen langfristig abnimmt.
Sollte sich der tendenzielle Fall der Profitrate nicht aufhalten lassen, würde er zu einer unüberwindbaren Grenze der kapitalistischen Akkumulation werden und könnte die Überlebensfähigkeit des Kapitalismus als Wirtschafts- und Gesellschaftssystem gefährden. (Karl Marx); (9)
Und so erklären sich generell die Handlungsoptionen kapitalistischer Unternehmen, Profit-Einschränkungen nach Möglichkeit durch Kosten-Einsparungen, technologische Rationalisierung, Produktionsoptimierungen und Verlagerungen zu kompensieren, was die Zahl der Beschäftigten reduziert und zugleich die gesamtgesellschaftliche Nachfrage senkt. (10)
Der daraus resultierende Nachfragemangel wird in der bürgerlichen Ökonomie als „Konsumzurückhaltung“ gedeutet, während er in Wahrheit Ausdruck der krisenhaften Dynamik der Überproduktion ist. Die strukturelle Perspektivlosigkeit bleibt bei fortgesetztem Personalabbau dabei ungelöst bestehen. Eine wahrhaft echte Perspektive wäre durch den Fokus auf die Aufhebung der Ausbeutung und der Schaffung gesellschaftlicher Produktionsverhältnisse zu sehen, statt auf individuelles Konsumverhalten. (11)
Die politische Rhetorik der aktuellen Bundesregierung verstärkt die „Vertrauenskrise“Die angekündigte Reformoffensive im Herbst durch die Bundesregierung zielt darauf ab, staatliche Aufgaben zurück in private Hände zu überführen und die Arbeitsmärkte zu deregulieren. Diese Maßnahmen werden politisch begleitet mit der Aufforderung an Gewerkschaften und Interessensvertreter der Arbeiterschaft, bei Lohnverhandlungen, Forderungen nach Weihnachtsgeld sich zurückzuhalten, um zum Erhalt von Arbeitsplätzen beizutragen. Gleichzeitig wächst auch der Druck auf die Vertretungen der Beschäftigten, insbesondere der Gewerkschaften, welche sich im Rahmen einer vermeintlichen Tarifpartnerschaft und einem gesellschaftlichen Konsens darauf konzentrieren sollen, die Profitabilität zu gewährleisten, anstatt die gesellschaftliche Reproduktion sicherzustellen.
Die derzeitige Regierungskoalition aus CDU/CSU und SPD übernimmt dabei die Rolle des „ideellen Gesamtkapitalisten“, der die langfristigen Bedingungen für die Kapitalverwertung schafft und absichert. Aber das scheint bei den Unternehmern und Kapital-Verwaltern nicht anzukommen und den Erwartungen nicht zu entsprechen. So betrachtet wird die beschriebene „Vertrauenskrise“ zur ideologischen Frage der fortschreitenden Verwertungsprobleme innerhalb der Kapitalfraktion des in der Studie berücksichtigten Industrie-Sektors.
Festzuhalten bleibt, dass die hier behandelte „Vertrauenskrise“ als eine Erscheinungsform bürgerlicher Ideologie eingeordnet werden kann. Eine Vertrauenskrise ist in der kapitalistischen Vergesellschaftung keine Störung sozialen Zusammenhalts, sondern Ausdruck ihrer strukturellen Widersprüche. Vertrauen wurzelt in einer kapitalistischen Gesellschaft nicht im direkten persönlichen Kontakt, in gemeinsamer Erfahrung oder gegenseitiger Verlässlichkeit, wie es in gemeinschaftlichen Strukturen der Fall wäre. Stattdessen entsteht es durch abstrakte, unpersönliche Mechanismen, über den Markt, über das Geld und über das Eigentum. Menschen vertrauen nicht direkt einander, sondern den Institutionen und Mechanismen des Kapitalismus, die ihre gesellschaftlichen Beziehungen durch Konkurrenz und Profitstreben vermitteln.
Wenn diese Vermittlungen – etwa in Finanz- oder Produktionskrisen – brüchig werden, erscheint der Verlust von Vertrauen als moralisches oder psychologisches Problem, als Versagen einzelner Akteure, Institutionen oder als Brüche im Glauben an den Markt, aber nicht als Folge des kapitalistischen Gesellschaftssystems. Und dadurch überdeckt die Rede von der Vertrauenskrise die eigentliche Ursache: die Instabilität kapitalistischer Vergesellschaftung selbst.
Die Untersuchungsergebnisse der Allensbach-Studie Unternehmer verweisen u. a. auf massiv geplante Produktionsverlagerungen der deutschen Industrie-Unternehmen. Es geht den Unternehmen offensichtlich darum, gezielt Standorte mit günstigeren Steuergesetzen und weniger bürokratischen Hürden im Ausland zu nutzen. Erwartet werden niedrige Körperschaftssteuersätze, Steuervergünstigungen für Investitionen sowie flexible Arbeitsgesetze, um eine merkliche Erhöhung des Nettoprofits realisieren zu können. In der Folge belegen die befragten Unternehmen ihr offen vorgetragenes Interesse am Sozialabbau und an Steuerentlastungen. Die Unternehmerklasse übt (auch) dadurch politischen Druck aus, damit der Standort Deutschland vor allem für sie wettbewerbsfähig bleibt. Die aktuelle Bundesregierung kommt diesen Forderungen mit steuerpolitischen Reformen entgegen, beispielsweise durch Senkung der Körperschaftssteuer und Entlastung bei Stromkosten. Doch für viele Unternehmen erfolgt dies offenbar zu langsam oder ist von ihrer Wirksamkeit für sie zu wenig.
Die Lohnabhängigen in Deutschland tragen die negativen Folgen dieser sich abzeichnenden Strukturverlagerungen; Arbeitsplatzverlust, Lohndruck und die Gefahr von Sozialabbau sind direkte Ergebnisse geplanter und sich vollziehender Auslandsverlagerung der Produktion. Das Kapital nimmt dies in Kauf, da die Sicherung der Profitrate im globalen Maßstab Vorrang vor nationalen sozialen Interessen hat.
-----------------
Quellen:
(2) W. Sabautzki: Reine Klassenpolitik, in Marxistische Blätter,4/2025;
(8) Ulf Immelt: Transformation, Krise, Deindustrialisierung, in Marxistische Blätter, 4/25
(9) https://zeitschrift-luxemburg.de/artikel/der-tendenzielle-fall-der-profitrate/
(11) H. Zdebel: Klassenkampf statt Konsumkritik, in: nd Journalismus von links, 2017
Kriegstreiber John Bolton Angeklagt
In diesem Video, das exklusiv auf Deutsch auf unserem Kanal veröffentlicht wurde, kommentiert der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Journalist Glenn Greenwald die Anklage gegen den ehemaligen US-Sicherheitsberater John Bolton wegen des Missbrauchs von Verschlusssachen. Er untersucht die Details des Falls und die breiteren Reaktionen der Medien und der Politik darauf. Dieses Video wurde von System […]
Der Beitrag Kriegstreiber John Bolton Angeklagt erschien zuerst auf acTVism.
Wer verdient am Krieg?
Kaum ein Industriezweig ist so mächtig und zugleich so unsichtbar wie die Rüstungsindustrie. Während Politikerinnen und Politiker von „Sicherheit“ sprechen und Medien neue Waffensysteme als Fortschritt feiern, arbeitet im Hintergrund ein Netzwerk aus Unternehmen, Banken und Lobbygruppen daran, dass das Geschäft mit dem Krieg weiterläuft. Die Informationsstelle Militarisierung (IMI) hat mit ihrem Beitrag „Überblick zu den Akteuren der Rüstungsindustrie“ eine wichtige Bestandsaufnahme vorgelegt. (1) Auf dieser Grundlage lohnt es sich, genauer hinzusehen: Wer sind die eigentlichen Profiteure, wie ist dieses System organisiert – und warum scheint es in unserer Gesellschaft so selbstverständlich geworden zu sein?
Die Netzwerke des KriegesDie Rüstungsindustrie ist weit mehr als nur Panzer, Raketen und Flugzeuge. Hinter den sichtbaren Symbolen militärischer Macht verbirgt sich ein eng verknüpftes Geflecht aus Herstellern, Zulieferern, Forschungsinstituten, Finanzinvestoren und politischen Entscheidungsträgern. Es gibt die großen Namen – Rheinmetall, Hensoldt, Airbus Defence – aber daneben gibt es unzählige kleinere Firmen, die Sensoren, Software, Elektronik oder Spezialteile liefern (5). Zusammen bilden sie eine internationale Wertschöpfungskette, deren Bestandteile sich über Kontinente verteilen. Ein Waffensystem, das in Deutschland gebaut wird, enthält Bauteile aus Frankreich, den USA oder Südkorea; das Kapital stammt oft aus internationalen Fonds. Krieg ist ein globalisiertes Geschäftsmodell. (2)
Diese globale Struktur hat Geschichte. Schon im Kalten Krieg war die Rüstungsindustrie der Motor eines gigantischen technologischen Wettlaufs. Nach 1990 hofften viele auf eine „Friedensdividende“, auf Abrüstung und zivile Umorientierung. Doch statt Stillstand kam die Umrüstung: Rüstungsfirmen suchten neue Märkte, neue Bedrohungsnarrative, neue Produkte. Aus der klassischen Waffenproduktion wurde ein High-Tech-Sektor, der sich mit Schlagwörtern wie „Cyberabwehr“, „Künstliche Intelligenz“ oder „Drohnen“ neu erfand. Der Krieg modernisierte sich – und mit ihm die Industrie, die davon lebt. (3)
Entscheidend für ihr Überleben war und ist die Politik. Denn ohne staatliche Aufträge gäbe es diese Branche nicht. Regierungen sind ihre besten Kunden. Wenn es um Verteidigungsbudgets geht, wird nicht gespart, sondern investiert. Politikerinnen und Politiker rechtfertigen das mit denselben Argumenten, die sich seit Jahrzehnten bewährt haben: Arbeitsplätze sichern, technologische Souveränität wahren, internationale Verpflichtungen erfüllen (4). Wer dagegenhält, gilt schnell als „unverantwortlich“ oder „naiv“.
Demnach lebt die Rüstungsindustrie nicht vom freien Markt – sie lebt von der Politik. Der IMI-Artikel zeigt deutlich, wie eng Industrie und Politik miteinander verflochten sind. Exportbeschränkungen werden gelockert, Aufträge bevorzugt an nationale Anbieter vergeben, bürokratische Hürden abgebaut. Regierungen präsentieren das als notwendige Maßnahme zur „Sicherheit“, tatsächlich aber dient es oft dazu, wirtschaftliche Interessen zu stabilisieren. Die Branche ist dabei höchst profitabel – nicht, weil sie gesellschaftlichen Nutzen stiftet, sondern weil sie von einem garantierten Absatzmarkt lebt. Solange Staaten aufrüsten, fließt das Geld. (5)
Dass Rüstung kein normales Wirtschaftsgut ist, wird gern verschleiert. Volkswirtschaftlich betrachtet ist sie unproduktiv: Sie erzeugt nichts, was man konsumieren oder wiederverwenden könnte. Ihre Produkte dienen dazu, zu zerstören. Trotzdem gilt die Branche als Wachstumssektor. (6) Sie profitiert von Unsicherheit, von geopolitischen Spannungen, von Kriegen. Jede Krise, jede Eskalation lässt die Aktienkurse steigen. In diesem System ist Frieden kein ökonomisches Ziel, sondern ein Risiko.
Sprache, Macht und TransparenzParallel zur wirtschaftlichen und politischen Verflechtung hat sich ein professionelles Netzwerk etabliert, das die öffentliche Wahrnehmung steuert. Lobbyverbände beraten Ministerien, Think Tanks schreiben Studien über „Sicherheitsbedarfe“, PR-Agenturen polieren das Image. In Medien erscheinen Vertreterinnen und Vertreter der Branche regelmäßig als Expertinnen und Experten, die vermeintlich objektiv erklären, warum Aufrüstung unausweichlich sei. So verschwimmen die Grenzen zwischen Information, Meinung und Interessenvertretung. Je komplexer die Strukturen, desto schwerer fällt es, Verantwortlichkeiten zu erkennen. Wer verdient eigentlich an einem Krieg? Wer liefert, wer genehmigt, wer finanziert? Diese Fragen bleiben oft unbeantwortet, weil sie in einem Geflecht aus Geheimhaltung, technischer Sprache und politischen Phrasen untergehen.
Besonders auffällig ist die Macht der Sprache. Begriffe wie „Verteidigungsgüter“ oder „Sicherheitskooperation“ verwandeln Waffenexporte in etwas Harmloses, beinahe Notwendiges. Rhetorisch wird aus „Aufrüstung“ die „Stärkung der Verteidigungsfähigkeit“, aus „Kriegsgerät“ ein „Beitrag zur Friedenssicherung“. Medienberichte übernehmen diese Vokabeln oft unkritisch. Neue Panzer oder Drohnen werden wie Innovationen im Technikteil präsentiert – es geht um Reichweite, Präzision, Effizienz. Über Ethik, über die sozialen und ökologischen Folgen militärischer Produktion wird selten gesprochen. So entsteht ein Klima, in dem militärische Logik zur Normalität wird. (7)
Doch auch wenn die Rüstungsindustrie ihre Strukturen geschickt verbirgt, ist sie nicht unangreifbar. Die IMI zeigt mit Projekten wie den „Vernetzten Waffenschmieden“, wie viel sich offenlegen lässt, wenn man gezielt recherchiert. (2) Transparenz ist der erste Schritt: Wer die Verflechtungen kennt, kann sie benennen – und kritisieren. Ebenso wichtig ist es, den öffentlichen Diskurs zu verändern. „Sicherheit“ darf nicht länger automatisch „Militär“ bedeuten. Echte Sicherheit entsteht durch Bildung, soziale Gerechtigkeit, Energieunabhängigkeit und internationale Kooperation, nicht durch immer neue Waffenprogramme.
---------------------
(1) https://www.imi-online.de/2025/09/25/ueberblick-zu-den-akteuren-der-ruestungsindustrie/
(2) https://www.rosalux.de/vernetzte-waffenschmieden
(3) https://www.imi-online.de/download/IMI_Handbuch_Ruestung_web.pdf
(4) https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/ruestung-aufschwung-100.html
(5) https://www.dw.com/de/r%C3%BCstungsindustrie-boomt-wer-profitiert-davon/a-73115190
(6) https://taz.de/Wirtschaftlichkeit-von-Aufruestung/!6075375/
-----------------------
Siehe auch isw-report 140 "Die Zeitenwende und der Militär-Industrie-Komplex
Syrien – ein Schauplatz widerstreitenden Ringens um die Neugestaltung des Nahen und Mittleren Ostens
Wenn es um die heutige Neugestaltung der nah- und mittelöstlichen Regionalordnung geht, so bildet Syrien aktuell dafür einen der Hauptschauplätze. Mit dem Sturz von Baschar Al-Assad im Dezember 2024 ist dieses durch die Stellvertreterkriege arg gebeutelte Land nunmehr zu einem Schlüsselglied dabei geworden, auf welcher Grundlage die künftige Ordnung in der Region verfasst sein wird.
Während es für die USA und Israel, namentlich für US-Präsident Donald Trump und Israels Premier Benjamin Netanjahu, anscheinend nahezu selbstverständlich ist, dass die neuen Machtverhältnisse in Syrien dem von ihnen unter beider Ägide angestrebten Neuen Nahen und Mittleren Osten in die Karten spielen; versuchen andere Staaten der Region hingegen, diese Entwicklungen zu nutzen, um eine Regionalordnung zu begründen, die auf fairem Interessenausgleich sowie auf dem Prinzip von Dialog und Diplomatie statt auf einseitigen Sicherheits- und Hegemonieansprüchen basiert.
USA und Israel auf vermeintlichem SiegeszugAus Sicht der USA scheint klar zu sein, dass sie in Syrien gewonnen haben. Der Regime-Change, auf den sie fast ein Jahrzehnt lang gezielt hingearbeitet hatte, (1) ist nunmehr Realität. Das bedeutet für die USA, nach fast sechs Jahrzehnten dezidiert antiwestlicher Ausrichtung syrischer Politik jetzt wieder unmittelbaren Einfluss auf die Politikgestaltung in Damaskus nehmen zu können – zumal die neuen Machthaber sichtlich in ihrer Schuld stehen und sich dementsprechend offen zeigen müssen. Denn sowohl ihre Machtübernahme als auch ihre nachfolgende Anerkennung auf der internationalen Bühne verdanken sie in hohem Maße den USA. Wie sonst wäre es vorstellbar gewesen, dass Personen, die zuvor auf US-Terrorlisten gestanden und auf deren Ergreifung sogar Kopfgelder in Millionenhöhe ausgesetzt worden waren – wie beispielsweise Interimspräsident Ahmed Al-Scharaa noch unter seinem Kampfnamen Al-Julani – sich, ohne je zur Rechenschaft gezogen worden zu sein, als die neuen Hoffnungsträger vor der UNO präsentieren? Ganz abgesehen davon hängt es hauptsächlich von den USA ab, inwieweit die noch gegen Syrien bestehenden, und das Land knechtenden Sanktionen in Gänze aufgehoben werden. Nicht umsonst bemühten sich sowohl Interimspräsident Al-Scharaa als auch Außenminister Asaad Hassan Al-Shaibani während ihres Besuches in den USA und den dabei geführten Gesprächen auf offizieller Ebene – darunter auch im Senat (2) – um eine Aufhebung aller dieser Sanktionen.
Ein wichtiges Anliegen der US-Politik gegenüber Syrien besteht erklärtermaßen darin, dass Syrien die Normalisierung der Beziehungen zu Israel vorantreibt – offenkundig unabhängig davon, welche Politik Israel gegenüber Syrien verfolgt. Weil es letzten Endes um das gemeinsame Ziel geht, die Hegemonie in der Region zu sichern.
Offenbar beabsichtigt Israel, basierend auf seinen Erfolgen auf dem Schlachtfeld und dem darauf gegründeten Dominanzanspruch in der Region, die politische Landkarte Syriens völlig neu zeichnen. Ziel scheint zu sein, die bestehende territoriale Struktur des Landes zu verändern, um – gemäß seinem einseitigen Sicherheitsverständnis – sicherzustellen, dass Syrien künftig keine Bedrohung mehr für Israel darstellt. Statt weiterhin als einheitlicher Staat zu existieren, soll Syrien möglichst in mehrere Entitäten auf der Basis religiöser bzw. ethnischer Merkmale - eine drusische, eine alawitische, eine sunnitische sowie eine kurdische – aufgespaltet werden.
Sicherlich nicht zufällig kursieren neuerdings im israelischen Regierungs-Diskurs frühere zionistische Pläne eines Groß-Israel – wie beispielsweise der Yinon Plan, (3) der in seiner Grundstruktur jener Teilung Syriens in mehrere separate Provinzverwaltungen zu Zeiten der französischen Kolonialherrschaft ähnelt. So ließe sich auch erklären, warum sich Israel ausgerechnet zur Schutzmacht der syrischen Drusen ausgerufen hat. Nach Berichten von Haaretz und Reuters (Mitte September) unterstützt es inzwischen drusische bewaffnete Kämpfer mit Geld, Munition und anderem Kriegsgerät. Ebenso werden die Kurden auch weiterhin dazu ermuntert, ihre Eigenständigkeit gegen Damaskus zu behaupten.
Nicht zuletzt scheint es für Israel darum zu gehen, weiteres syrisches Territorium – mehr oder weniger offiziell – kontrollieren zu können, nachdem es bereits die Kontrolle über die gesamten Golan-Höhen und den Berg Hermon völkerrechtswidrig an sich gerissen hat. Umso mehr wird abzuwarten sein, wie das Sicherheitsabkommen dann tatsächlich aussieht, über welches seit einigen Monaten zwischen beiden Seiten verhandelt wird. Bislang bekannte Eckpunkte lassen darauf schließen, dass Israel seinen Anspruch auf die von ihm 1967 besetzten und 1981 annektierten syrischen Golan-Höhen künftig vertraglich absichern könnte. (4) Bereits während seiner ersten Amtszeit hatte US-Präsident Donald Trump – unter Bruch allen Völkerrechts – die syrischen Golan-Höhen als israelisches Staatsgebiet anerkannt. Ein Verzicht auf dieses Territorium dürfte von der syrischen Gesellschaft allerdings kaum widerspruchslos hingenommen werden.
In seiner Rede vor der UNO verurteilte der syrische Interimspräsident die auch noch nach dem Assad-Sturz am 8. Dezember 2024 beständigen israelischen Angriffe auf Syrien als Bedrohung – nicht nur für sein Land, sondern für die gesamte Region.
Regionalmächte als immer entschlossenerer GegenpartInsbesondere die beiden Regionalmächte Türkei und Saudi-Arabien, die – wenn auch aus unterschiedlichen Gründen – zu den Gewinnern des Assad-Sturzes zählen, versuchen, ihre Positionen hinsichtlich der Syrien-Frage zu nutzen, um Israels Streben nach uneingeschränkter Machtdominanz in der Region entgegenzuwirken. Dies geschieht allerdings jeweils entlang ihrer eigenen Interessen und unter Beibehaltung enger Beziehungen zu den USA, was durchaus teilweise erhebliche politische Spannungen impliziert. Immerhin ist die Türkei NATO-Mitglied, während Saudi-Arabien seit Jahrzehnten in einer strategischen Partnerschaft mit den USA steht.
Für die Türkei, deren Beziehungen zu den neuen Machthabern besonders eng sind – manche Beobachter sprechen von Syrien bereits als einem türkischen Protektorat – steht die Kurdenfrage mit an vorderster Stelle. Die Türkei widersetzt sich jeglicher Abtrennung jener hauptsächlich von Kurden getragenen Autonomen Administration in Nord- und Ost-Syrien (AANES). Ebenso drängt sie auf die Integration der dortigen Kampfeinheiten, der Syrian Democratic Forces (SDF), in die reguläre syrische Armee und fordert eine zügige Umsetzung des am 10. März zwischen der SDF und Damaszener Machthabern unterzeichneten Abkommens. Umso herausfordernder stellt sich dementsprechend für sie das Bestreben Israels dar, die Kurden für die mögliche Realisierung des von Netanjahu bereits positiv goutierten Groß-Israel-Konzepts zu instrumentalisieren zu suchen.
Um dem zu begegnen, intensiviert die Türkei ihre Beziehungen mit Damaskus in allen Bereichen, darunter insbesondere auch auf nachrichtendienstlichem und militärischem Gebiet. Auf der Grundlage des im August zwischen beiden Ländern vereinbarten Militärabkommens will die Türkei insbesondere daran mitwirken, eine einheitliche, reguläre syrische Armee aufzubauen – was gleichfalls Israels Ambitionen auf ein verteidigungsunfähiges Syrien als Nachbarn entgegensteht.
Für Saudi-Arabien, das eine zentrale Rolle als regionale Führungsmacht mit globaler Ausstrahlung anstrebt, ist Syrien schon aufgrund seiner geografischen Lage in der Levante von besonderer strategischer Bedeutung.
Im Mittelpunkt der saudischen Syrien-Politik steht vor allem, das Land politisch und ökonomisch nach Kräften stabilisieren zu helfen. Nicht ohne Eigennutz hat sich Saudi-Arabien vehement für die Anerkennung der neuen Damaszener Machthaber und deren Aufnahme in die arabische Staatenfamilie eingesetzt. Zudem vermittelte es die Kontaktaufnahme zwischen Trump und Al-Scharaa und trug damit wesentlich zu dessen internationaler Reputation bei. Auch auf wirtschaftlichem Gebiet engagiert sich Riad vielfältig für Syrien. Nicht nur hat es zusammen mit Qatar für die syrischen Weltbank-Kredite gebürgt; überdies wurden verschiedene Abkommen im Umfang von Milliarden USD zur Entwicklung wirtschaftlicher Schlüsselindustrien wie zur Trümmerbeseitigung vereinbart.
Ungeachtet aller Interessenunterschiede zwischen der Türkei und Saudi-Arabien auf syrischem Boden besteht indessen ausdrückliches Einvernehmen darüber, die Einheit und territoriale Integrität Syriens in seinem bisherigen Bestand zu bewahren und jeglicher Aufgliederung des Landes in einzelne Entitäten entschieden entgegenzutreten. Ebenso verurteilen beide Staaten das gegenwärtige militärische Vorgehen Israels in der Region.
Vor diesem Hintergrund fällt auf, dass Ankara und Riad – im Kontext der politischen Umbrüche in Syrien sowie des immer aggressiveren Vorgehens Israels – ihre Zusammenarbeit zunehmend auch auf den Sicherheitsbereich ausdehnen. So erhob unlängst der türkische Außenminister, Hakan Fidan, die Forderung nach einem gemeinsamen Sicherheitsmechanismus, der der neben ihnen insbesondere auch Ägypten sowie weitere Staaten der Region einbeziehen soll. Ziel ist es offenbar, eine größere strategische Autonomie zu erreichen und so die entstehende Regionalordnung im Sinne der Prinzipien friedlicher Koexistenz zwischen den Staaten und Völkern des Nahen Ostens aktiv mitzugestalten
---------------------------
(1) Bis dann dahin, wie der US-Botschafter zu Assads Zeiten, Robert Ford, Mitte Mai in einem Gespräch mit dem Baltimore Council on Foreign Affairs ausgeplaudert hat, von einer britischen, mit dem MI6 in Zusammenhang gebrachten NGO angesprochen worden zu sein, aus Al-Julani einen Politiker von staatsmännischem Format machen zu sollen. Ihn also – im Zuge eines Regime-Change der besonderen Art – zu dem heutigen Al-Scharaa werden zu lassen.
(2) So traf sich Al-Shaibani am 19. Mai mit Mitgliedern des Komitees für Internationale Beziehungen beim US-Senat, zum Gespräch über die Dringlichkeit eines stabilen, wirtschaftlich prosperierenden Syriens sowie die daraus resultierende Notwendigkeit der Sanktionsaufhebung. Vgl. dazu https://sana.sy/en/politics/2268352/
(3) Ein Plan, der in den 1980er Jahren vom israelischen Journalisten Oded Yinon entwickelt worden sein soll und der auf die Errichtung zweier sunnitischer Staaten – einen um Aleppo und einen um Damaskus gruppiert –, eines alawitischen Staates entlang der syrischen Mittelmeerküste sowie eines drusischen Staates im Süd-Südwesten Syriens optiert hat und bei dem die Kurden als befreundet ausgewiesen sind
(4) Was unter der Assad-Herrschaft für Israel nicht zu erreichen gewesen ist. So waren gerade daran die einst noch unter der Präsidentschaft von Hafez Al-Assad geführten Verhandlungen über ein Friedensabkommen mit Israel gescheitert.
USA führen weiteren Krieg in Venezuela?
In diesem Video, das exklusiv auf Deutsch auf unserem Kanal veröffentlicht wurde, beleuchtet der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Journalist Glenn Greenwald die verborgene Rolle Washingtons in der politischen Krise Venezuelas. Warum ist die US-Regierung so stark in diesem südamerikanischen Land engagiert – und was steckt wirklich hinter ihrem Ruf nach „Demokratie“? Greenwald untersucht, wie die […]
Der Beitrag USA führen weiteren Krieg in Venezuela? erschien zuerst auf acTVism.
Psychiatrische Diagnosen als „Sicherheitsrisiko“
Das China-Syndrom: Amerikas Angst vor Chinas Aufstieg
In diesem Interview mit dem Historiker Peter Kuznick, Co-Autor von „Amerikas ungeschriebene Geschichte“ (zusammen mit Oliver Stone), geht es um die verdrängten Wendepunkte der US-Geschichte – von den unterdrückten Visionen eines Henry Wallace bis zur Eskalation des Kalten Krieges. Kuznick zeigt, wie aus verpassten Friedenschancen eine Politik der Angst entstand – und warum sich dieses […]
Der Beitrag Das China-Syndrom: Amerikas Angst vor Chinas Aufstieg erschien zuerst auf acTVism.
Den Betrieb entrüsten – Aktiv gegen Kriegstüchtigkeit
Die Wahrheit über den Friedensnobelpreis
In diesem Video, das exklusiv auf Deutsch auf unserem Kanal veröffentlicht wurde, hinterfragt der Pulitzer-Preisträger Glenn Greenwald die diesjährige Verleihung des Friedensnobelpreises 2025 an María Corina Machado, die Anführerin der venezolanischen Opposition. Doch was steckt wirklich hinter dieser Entscheidung? Ist der Friedensnobelpreis noch ein Symbol für Frieden – oder längst ein Werkzeug politischer Einflussnahme? Greenwald […]
Der Beitrag Die Wahrheit über den Friedensnobelpreis erschien zuerst auf acTVism.
Prof. Mearsheimer: Gaza-Waffenstillstand, Ukraine-Krieg & Eskalation mit China
In diesem Video, das exklusiv auf Deutsch auf unserem Kanal veröffentlicht wurde, interviewt der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Journalist Glenn Greenwald Prof. John Mearsheimer, amerikanischer Politikwissenschaftler an der Universität Chicago, über das Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hamas und dessen weitreichende geopolitische Auswirkungen. Das Gespräch befasst sich zudem mit den jüngsten Entwicklungen in der Ukraine […]
Der Beitrag Prof. Mearsheimer: Gaza-Waffenstillstand, Ukraine-Krieg & Eskalation mit China erschien zuerst auf acTVism.
Bitte jetzt anmelden zur 13. Tagung "We shall overcome!" am 8. November 2025 in Reutlingen
Der fehlende Kontext: Trumps „Friedensplan“ für Gaza & Tomahawk-Raketen für die Ukraine
In dieser Folge spricht unser Chefredakteur Zain Raza mit dem Historiker und Bestsellerautor Vijay Prashad über Donald Trumps 20-Punkte-Friedensplan für Gaza und darüber, ob dieser Plan einen dauerhaften Frieden zwischen Israel und Palästina herbeiführen kann. Das Gespräch wendet sich dann der Ukraine zu, wo Berichte über Pläne der USA, Tomahawk-Raketen zu liefern, neue Fragen über […]
Der Beitrag Der fehlende Kontext: Trumps „Friedensplan“ für Gaza & Tomahawk-Raketen für die Ukraine erschien zuerst auf acTVism.
Forscher warnt: „Übermenschliche KI würde uns alle töten“
In diesem Video, das exklusiv auf Deutsch auf unserem Kanal veröffentlicht wurde, interviewt der Journalist Lee Fang Nate Soares zu seinem neuen Buch If Anyone Builds It, Everyone Dies: Why Superhuman AI Would Kill Us All (Wenn jemand sie baut, sterben alle: Warum übermenschliche KI uns alle töten würde). Soares legt seine These dar, dass […]
Der Beitrag Forscher warnt: „Übermenschliche KI würde uns alle töten“ erschien zuerst auf acTVism.
Israels Propagandaoffensive: Influencer erhalten 7.000 Dollar pro Beitrag
In diesem Video, das exklusiv auf Deutsch auf unserem Kanal veröffentlicht wurde, interviewt der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Journalist Glenn Greenwald Nick Cleveland Stout zu dessen Berichterstattung über Israels Bemühungen, die amerikanische Öffentlichkeit durch verdeckte Social-Media-Kampagnen zu beeinflussen. Stout hat Beweise dafür gefunden, dass Israel Influencern bis zu 7.000 Dollar pro Beitrag zahlt, um pro-israelische […]
Der Beitrag Israels Propagandaoffensive: Influencer erhalten 7.000 Dollar pro Beitrag erschien zuerst auf acTVism.
Friedensorganisationen starten Abrüstungsappell
"Sittlichkeit als Grundforderung des Judentums"
Gaza-Waffenstillstand & Deutschlands Besessenheit von Israel | Antony Loewenstein
In dieser Folge von Die Quelle spricht unser leitender Redakteur Zain Raza mit dem preisgekrönten Journalisten, Autor und Filmemacher Antony Loewenstein über die neuesten Entwicklungen rund um Israel und Palästina. Sie diskutieren den kürzlich verkündeten Waffenstillstand im Gazastreifen und Donald Trumps 20-Punkte-Friedensplan und konzentrieren sich dabei auf die Frage, ob das Abkommen Bestand haben kann […]
Der Beitrag Gaza-Waffenstillstand & Deutschlands Besessenheit von Israel | Antony Loewenstein erschien zuerst auf acTVism.
Trump beschimpft Netanjahu: Warum Israels Ansehen in den USA fällt
Nachdem Trump und Netanjahu am 30. September ein Ultimatum an die Hamas gestellt hatten, veröffentlichte diese eine Erklärung, in der sie zentrale Punkte des Ultimatums akzeptierte, andere jedoch diplomatisch zurückwies. Zugleich signalisierte sie Bereitschaft zu weiteren Gesprächen über offene Fragen. Trump forderte daraufhin ein Ende der israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen, was Netanjahu ablehnte. Berichten […]
Der Beitrag Trump beschimpft Netanjahu: Warum Israels Ansehen in den USA fällt erschien zuerst auf acTVism.